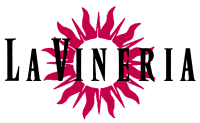Ich muss zehn oder elf Jahre alt gewesen sein als ich in der Bibliothek meiner Eltern ein Taschenbuch mit dem provozierenden Titel „Der Ekel“ fand. Von seinem Autor Jean-Paul Satre hatte ich in Gesprächsfetzen meiner Eltern auch schon gehört. Er sei „ein Linker“ und Kommunist hatte ich vernommen und, dass beides nichts Erstrebenswertes war, wurde gleich dazu gesagt. Der aufreizende Titel des Buches und die Fragwürdigkeit seines Autors reizten meine Neugierde und so beschloss ich dieses Buch zu lesen. „Das ist, weiß Gott, nichts für Kinder“ war die einhellige Meinung meiner Mutter und meines Vaters und damit bekam das Buch noch eine weitere Eigenschaft, die mich ganz besonders reizte: seine Lektüre war für mich verboten! Also musste ich es lesen. Ich steckte das kleine Büchlein zurück in den Bücherschrank, allerdings an eine völlig andere Stelle und dachte mir dabei, dass meine Eltern, wenn sie es selbst lesen wollten, mich schon fragen würden wo das Buch sei, denn ich hatte es ja als letzter in der Hand. Sollte „Der Ekel“ die nächsten Wochen unbeachtet bleiben, wollte ich das Buch mit in die Sommerferien mitnehmen und dort dann ungestört lesen. In den darauf folgenden Wochen wurde das Buch nicht gesucht und so landete es gut versteckt in meinem Feriengepäck.
Ich erinnere mich an einen ganz besonderen Sommer in Oberbayern, so einer wie er nur in der Kindheit vorkommt, herrlich warm, jeden Tag schönes, sonniges Wetter um mich herum die Küchendüfte des Landhauses meiner Großeltern und der Geruch der Landwirtschaft. Ich suchte mir ein Versteck in einem Pflaumenbaum, dessen Früchte bald reif waren, und begann in „Der Ekel“ zu lesen. Heute habe ich noch eine vage Vorstellung von der Figur des Antoine Roquentin, der ständig etwas tat oder dachte, dessen Sinn oder Bedeutung ich nicht verstand. Bei jedem Umblättern einer Seite glaubte ich, dass nun jenes Geheimnis kommen müsse, von dem meine Eltern meinten, es sei nicht für die zarte Kinderpsyche ihres Sohnes geeignet. Aber es kam nichts und zurück blieb bei mir eine vordergründige Enttäuschung. Tief in mir allerdings wuchs das Bewusstsein meiner kindlichen Ignoranz und der dringende Wunsch eines Tages die Welt der Erwachsenen verstehen zu können.
An den Abenden meines unfruchtbaren Zusammentreffens mit der Philosophie von Sartre fand eine andere, dem 11-Jährigen deutlich mehr Eindruck hinterlassende Begegnung statt: der allabendliche Weingenuss meines Großvaters. Schon beim Mittagessen stieß er eine Diskussion darüber an, was man denn heute Abend trinken sollte, damit er die entsprechenden Flaschen kaltstellen konnte. Meine Großmutter gab den Speisezettel für den Abend kund und meist wurde dann versucht sich zunächst einmal auf die Geographie des Weins festzulegen. Solle es ein Möselchen, ein Rheinwein, ein Pfälzer oder gar ein Boxbeutel sein? Außer den genannten und einem Burgunder gab es im Keller meines Großvaters keine anderen Weine. Die Argumente für oder wider den einen oder anderen habe ich meist so wenig verstanden wie die Texte Sartres am Morgen im Pflaumenbaum. Das Resultat war aber weitgehend ähnlich: ich wollte erwachsen werden um über den Wein mitreden zu können, mich faszinierte diese Welt.
Mein Großvater verstand meine Neugier und gelegentlich stellte er ein gering mit Wein gefülltes Glas vor mich hin und forderte mich auf zu kosten. Das brachte regelmäßig meine Eltern auf den Plan, die dem gutmeinenden Patriarchen überdeutlich machten, dass es nicht angehe einen 11-Jährigen zum Alkohol zu verleiten. “Wein ist, weiß Gott, nichts für Kinder“ ertönte es einmal mehr aus einer Sofaecke. Bevor ich das Glas allerdings wieder abgeben musste nippte ich daran und so lernte ich langsam tatsächlich die Regionen am Geschmack zu unterscheiden. Schließlich bin ich erwachsen geworden und musste feststellen: der Existenzialismus Sartres hat mein Leben nicht verändert, der Wein meines Großvaters schon!