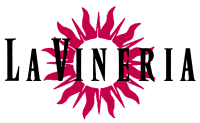Mit dieser Tatsache muss ich leben: ich habe keine richtige Begabung für die Musik. So traurig das klingt: ich kann keine Noten lesen, ich spiele kein Instrument, kann nicht einmal singen, wiedererkenne nur schwerlich eine einmal gehörte und etwas komplexere Melodie und bin ein lausiger Tänzer. Aber ich liebe die Musik über alles, und das schon sehr lange! Dass ich mich als kompletter Laie dennoch immer wieder an die Peripherie der Musikwissenschaften herantraue, mögen mir die akademischen Schriftgelehrten verzeihen und dabei meine Herangehensweise gerne als dilettantisch einstufen. Hoffentlich erinnern sie sich dann aber auch daran, dass Dilettantismus einst überhaupt keine negative Bedeutung hatte und lediglich eine Beschäftigung bezeichnete, die in der Kunst (oder ggf. auch in der Wissenschaft) reine Liebhaberei sah, die den Betroffenen ausschliesslich zum Vergnügen diente. Der Dilettant hatte in seinem Fach keine Ausbildung und heute würden wir vielleicht den Begriff Amateur für ihn oder sie verwenden, was ja nichts anderes als Liebhaber (lat.: amator) besagt. Berufsfremde Erfinder oder Entdecker wie Benjamin Franklin, Gregor Mendel oder Heinrich Schliemann belegen eindrucksvoll, dass Dilettantismus überhaupt nichts mit Stümperei oder Pfuscharbeit zu tun haben muss. Um Dilettant genannt werden zu können ist nicht einmal die praktische Ausführung der Liebhabertätigkeit unbedingt erforderlich, auch die „akademische“ Beschäftigung mit den Künsten oder Wissenschaften, die das genüssliche Anhören bzw. Ansehen sowie die nachfolgende Interpretation, oder das Verstehen wissenschaftlicher Zusammenhänge, beinhaltet, gehört selbstverständlich dazu. Leider waren es ausgerechnet unsere Dichterfürsten Friedrich Schiller und Johann Wolfgang von Goethe, die am positiven Bild des Dilettantismus erheblich gekratzt haben.
Im 31sten Band der Cotta´schen Ausgabe von Goethes gesammelten Werken aus dem Jahr 1857 finden wir einen Titel „Über den sogenannten Dilettantismus oder die praktische Liebhaberei in den Künsten, von 1799“ (1). Dabei handelt es sich um ein von Schiller und Goethe gemeinsam erarbeitetes Fragment für eine von den beiden zu Lebzeiten leider nie fertiggestellte Schrift, die in Goethes Zeitschrift für bildende Kunst „Propyläen“ publiziert werden sollte. Darin findet sich folgende Behauptung: „Weil der Dilettant seinen Beruf zum Selbstproduciren erst aus den Wirkungen der Kunstwerke auf sich empfängt, so verwechselt er diese Wirkungen mit den objectiven Ursachen und Motiven und meint nun den Empfindungszustand in den er versetzt ist, auch productiv und praktisch zu machen; wie wenn man mit dem Geruch einer Blume die Blume selbst hervorzubringen gedächte.“ Dies besagt nichts anderes als, dass der Dilettant, die vom Kunstwerk bei ihm induzierte Emotion für seine persönliche Inspiration hält, daraus Kreativität entwickelt und das Ergebnis dann für eine eigene Leistung hält. Der schöne Vergleich mit der Blume ist sehr plastisch und trifft den Kern der Sache: alleine der Duft induziert eine Illusion von emotionaler Realität. Hierin sehe ich eine ganz wichtige Aufgabe des Dilettanten, denn er kann tatsächlich den Duft eines Kunstwerkes vermitteln, weil er sich zwischen dem Künstler und seinem Publikum positioniert hat. Goethe, der selbst ein äußerst talentierter, dilettierender Naturwissenschaftler und Maler war, hat sich deutlich zurückhaltender als Schiller zum Dilettantismus geäußert. Der hat den Dilettanten nämlich vorgeworfen, dass sie versuchten ohne große Mühen oder Studien ihre jeweilige Kunst auszuüben und „auch da bloß verständig spielen, wo Anstrengung und Ernst erfordert wird“ (2). Schillers Vorwurf lautet also, dass der Dilettant Verständnis nur vorspiele wo dies eigentlich ausschließlich mit „Anstrengung und Ernst“ zu erreichen wäre. In den bereits zitierten, gemeinsamen Aufzeichnungen von Schiller und Goethe über den “sogenannnten Dilettantismus“ finden wir auch dies: „Er (der Dilettant) kommt immer mehr von der Wahrheit der Gegenstände ab und verliert sich auf subjektiven Irrwegen.“ Dieser Tatbestand hängt eng mit der von den beiden Autoren postulierten Oberflächlichkeit und Sorglosigkeit des Dilettantismus zusammen, denn dort, wo kein ausreichender, geistiger Hintergrund bzw. Unterbau ist, kommt man sehr schnell ganz fürchterlich ins Schwafeln.
Wenn ich davon ausgehe, dass das Erschaffen von Wein eine Aktivität ist, deren Wesen zwischen Kunst und Wissenschaft hin und her pendelt, muss ich anerkennen, dass es auch einen önologischen Dilettantismus gibt. Der Wein-Dilettant muss sich nicht, ebenso wenig wie der Musik-Dilettant in der Musikwissenschaft, in der Tiefe der Kellerei-Technik bzw. -Wirtschaft auskennen. In anderen Worten, man muss nicht Winzer sein um guten Wein genießen und schätzen zu können. Aber man sollte schon ausreichend „Anstrengung und Ernst “ in sein Sujet investieren um nicht bei seinen Auslassungen darüber in die Schwatzhaftigkeit vieler „professioneller“ Weinkritiker zu verfallen.
(1) Johann Wolfgang von Goethe: Weimarer Ausgabe. Abt. 1, Reprint. dtv, München 1987.
(2) Friedrich Schiller : Ueber die nothwendigen Grenzen beim Gebrauch schöner Formen, in: Schillers Werke, NA Bd. 21, Weimar 1963, S. 19 ff.).
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit meiner Texte wähle ich, traditionsgemäß, die männliche Form. Die Formulierungen beziehen sich in aller Regel jedoch auf Angehörige aller Geschlechter, von denen ich selbstverständlich keines diskriminieren möchte!
Bleiben Sie stets neugierig …und durstig!