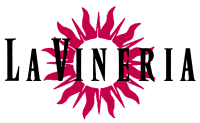Zugegeben, selbst als Naturwissenschaftler habe ich größten Widerwillen gegen die rein biochemischen Erklärungen sinnlicher Erfahrungen. Was ich damit meine, kann man historisch sehr gut an der Schmerzempfindung festmachen. Früher war der Schmerz ein durch und durch metaphysisches Ereignis, er rief den damit Gequälten offensichtlich zur Besinnung auf über sein Verhalten. Denn der Schmerz war vielleicht Gottes Strafe und Buße war die Schmerztherapie. Sie half oft genug und konnte damit die Richtigkeit des Glaubens an die Schmerzzusammenhänge beweisen. Heute weiß man, dass Schmerz eine durch organische Schäden verursachte Aktivierung bestimmter Rezeptoren ist, bei der biochemische Substanzen wie Prostaglandine, Serotonin, Neurotensin u.s.w. beteiligt sind. Entsprechend besteht die Therapie aus Medikamenten, die mit diesen Prozessen interagieren. Ob dies allerdings effektiver und mental befriedigender ist als die historische Methode bleibt dahingestellt.
Der göttliche Duft der Rose versinnbildlichte einst die Liebe, die Lebensfreude und die Ästhetik der gesamten Natur. Im Gegensatz dazu sieht die Naturwissenschaft im Rosenduft nur noch das relativ einfache und im Labor herstellbare Molekül mit dem nüchternen Namen 2-Phenylethanol. Was ich mit diesen beiden obigen Beispielen exemplarisch illustrieren will, ist die bedauernswerte „Entromantisierung“ unserer Sinnlichkeit. Wie es dem Schmerz und der Rose ergangen ist, ist es auch beim Wein, dem Getränk der Götter, gewesen. Was einst die Symbolik der engen Verbindung von lebensspendender Sonne und unserer Erde war, ist heute nur noch eine Lösung von Molekülen mit unterschiedlichen optischen Wellenlängen, die das Ergebnis vieler biochemischer und biophysikalischer Prozesse darstellen. Ignorieren dürfen wir Weinfreunde diese Entwicklung natürlich nicht, aber wir können verhindern, dass die neuen Erkenntnisse alte Mysterien vernichten, denn das Mysterium Wein möchte in jedem von uns weiterleben, dessen olfaktorische und gustatorische Rezeptoren in der Nase sowie an Zunge und Gaumen durch einen guten Tropfen in Erregung versetzt werden.
Eines der großen Mysterien unserer Wahrnehmung guter Weine ist ihr „Schmelz“. Ich habe hunderte von Weinbeschreibungen durchgelesen und bin immer wieder auf dieses eine Wort gestoßen. Jeder Schreiber gibt ihm einen ganz persönlichen Inhalt: während es einmal im Sinne von geschmeidiger Herzhaftigkeit gebraucht wird reden andere von Mundgefühl oder auch von der Altersaromatik. Die Harmonie von Tanninen mit der Säure wird, wenn sie bemerkenswert ist, häufig ebenfalls „Schmelz“ genannt. Selbst das deutliche Vorhandensein von Umami-Noten im Wein kann zur Empfindung von „Schmelz“ führen.
Bei aller Verschiedenartigkeit der Interpretation ist eines klar: Schmelz ist eine positive Eigenschaft des Weines und wird vom Genießer auch als solche wahrgenommen. Körperreiche und extraktreiche Weine bewirken gelegentlich ein ausgeprägtes „Mundgefühl“. Dieser in der wissenschaftlichen Sensorik etablierte und vielbenutzte Begriff beschreibt eigentlich haptische (ertastbare) Eindrücke im Mund, also die physikalischen und thermischen Zustände der Flüssigkeit (ölig, breiig, cremig, warm, kalt aber auch scharf und mild etc.). Wir reden ja beim Geschmack des Weins sehr bewusst auch von „Ecken und Kanten“, also von haptischen Eindrücken, die in diesem Fall selbstverständlich als Metapher gedacht sind. Den Schmelz können wir somit berechtigterweise auch in die Rubrik Mundgefühl einreihen. Er wird ja häufiger tatsächlich auch als „cremig“ bezeichnet.
Gerade Weine, die länger auf ihren Gärhefen im Tank oder Barrique liegen geblieben sind („sur lie“) zeigen oft viel Schmelz, so dass die Vermutung nahe liegt, dass die Hefezellen kausal etwas damit zu tun haben. Und ehe wir uns versehen sind wir wieder bei der nüchternen Biochemie! Tatsächlich sind es sog. Glycoproteine, aus den Zellwänden der Hefen, die in den Wein übertreten und sich zusammen mit hochwertigen Alkoholen (z.B. Glycerin) gustatorisch als Schmelz offenbaren. Auch die aus vorwiegend unreifen Trauben stammende Bernsteinsäure und deren Salze (Succinate) können als Geschmacksverstärker dazu beitragen, dass sich der Wein geschmacklich rund und warm, aber auch dicht und kräftig, eben „schmelzig“, präsentiert. Je länger der Wein auf der Hefe gelagert und mittels Bâtonnage umgerührt wird und damit mit der Hefe in engen Kontakt kommt, desto komplexer wird er. Dies bringt neben dem Schmelz auch die attraktiven nussig-buttrigen Töne in den Wein, insbesondere bei Rot- und Weißweinen, die im Barrique vergoren bzw. ausgebaut wurden.
Vielleicht ist es ja doch kein Fehler über die vielen Vorgänge bei der Entstehung der Primär-, Sekundär- und Tertiäraromatik aus wissenschaftlicher Sicht Bescheid zu wissen. Als Weinliebhaber steht man dann genau so erstaunt und bewundernd vor der Vielfalt der Fakten, die ja alle koordiniert nach einer Art von „Masterplan“ ablaufen müssen um am Ende jenes Mysterium in die Flasche zu bekommen, dem wir den Ehrentitel „Wein“ verliehen haben.