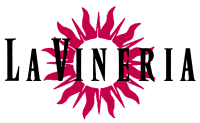Ein Porzellanbecher mit Carl Spitzwegs aufgedrucktem Gemäldeklassiker war einst das Danaergeschenk eines guten Bekannten für meine täglichen Kaffeepausen. Gut gemeint aber entsetzlich vulgär und kitschig, so jedenfalls war meine Einschätzung und das Objekt verschwand in der hintersten Ecke des Geschirrschrankes. Jetzt, in der Corona-Krise, suchte ich ein passendes Gefäß für den Tee, den ich mir zum vormittaglichen Schreiben bereiten wollte. Da entdeckte ich den Becher mit dem reproduzierten „armen Poeten“. Ich erinnerte mich, dass ich in meinen Münchner Studentenzeiten bei jedem Besuch der Neuen Pinakothek, und die gehörte damals zu meinen regelmässigen kulturellen Pflichtübungen, wie von magischer Hand gelenkt zuerst immer den Weg zu Spitzwegs Poeten suchte. „Das Lieblingsbild der Deutschen“ titelte die ZEIT-Online am 12. Januar 2012 anlässlich einer Versteigerung einer bislang unbekannten Version des kleinen Ölbildes. Kein Wunder, dass ich fortan täglich beim Teetrinken mit großem Vergnügen auf den mürrischen Herrn mit der Schlafmütze schaute und mir Gedanken machte, die ich immer weiter fortspann und die schließlich in einer fiktiven Biographie des armen Schriftstellers mündeten. Um mit ihm zu kommunizieren und ihn über seine Gewohnheiten ausfragen zu können, musste er einen Namen haben und ich taufte ihn „Berthold“, in Anlehnung an einen begabten Studienfreund („Studienstiftler!“). Sehr klar war mir sofort, dass Berthold in seinem von Spitzweg dargestellten Zustand auch eine Allegorie der aktuellen Corona-Krise sein musste, in der freischaffende Künstler mangels Anstellungs- und Verdienstmöglichkeiten am Hungertuch nagen müssen.
Der erste Eindruck vom Sujet des Malers ist immer wieder die erdrückende Klischeehaftigkeit des gesamten Inhaltes gewesen. Ein armer Dichter, der seine Werke im Ofen verbrennen muss um ein wenig Wärme in seine Bude zu bekommen, liegt angezogen mit wärmender Schlafmütze auf dem Kopf, auf seiner Matratze und sieht zu wie er zwischen dem rechten Daumen und Zeigefinger vermutlich einen Floh zerdrückt. Ist dies ein diskreter Fingerzeig auf die hygienischen Verhältnisse in des Poeten Atelier, oder gar ein Hinweis auf Mephistos Flohlied gesungen in Auerbachs Keller? Über ihm an der Zimmerdecke hängt ein aufgespannter Regenschirm in der Ecke, der aber das eindringende Wasser nicht aufhalten sondern nur zum Rand des Bettes umleiten kann – keine wesentlich verbesserte Situation bei starkem Regen! Trotz aller Erbärmlichkeit wirkt die Dachbude irgendwie anheimelnd und nötigt dem Betrachter ein Lächeln ab. Vielleicht auch deshalb, weil er eine gewisse Symphathie mit dem verarmten Dichter hat, der am helllichten Tage – die Sonne scheint mit schon fortgeschrittener Kraft durch das Fenster – im Bett dem Müßiggang verfallen ist. Auf seinen angezogenen Knieen liegt ein Manuskript, an dem er offensichtlich arbeitet. Die Schreibfeder hält er quer im Mund während er auf Inspiration wartet. Ob er durch die Brille, die er aus Schusseligkeit um 180 Grad verdreht auf der Nase sitzen hat, überhaupt sieht, ist ungewiss – auf alle Fälle wird sie ihm demnächt herunterfallen! Die vielen Bücher, die auf dem Fußboden vor der Matratze stehen und die teilweise Lesezeichen enthalten, lassen vermuten, dass Berthold sich auch skrupellos bei anderen Autoren Ideen holt.
Ganz besonders fasziniert mich seit meiner ersten Bekanntschaft mit dem Bild die schön bedruckte Pappschachtel neben dem Bett zwischen den Büchern. Entweder dient sie zur Aufbewahrung des Schreibpapiers oder ist der Verwahrungsort für intime Toilettenartikel. Der Kachelofen auf der gegenüberliegenden Seite des Dichterlagers scheint kalt zu sein. Als Heizmaterial sieht man auch nur gebündelte, alte Manuskripte. Die leere Waschschüssel und die ebenfalls leere Wasserflasche geben nochmals einen Hinweis auf die katastrophalen hygienischen Verhältnisse mit denen der arme Poet leben muss. Viel Aufwand wird er mit seiner Toilette wohl sicher nicht gemacht haben Der schäbige Mantel und der Spazierstock an der Wand sowie der hohe Zylinder am Ofenrohr geben einen kurzen Eindruck vom sozialen Auftreten meines Freundes vor der Krise, die ihn jetzt zum Verbleib in seinem Zimmer zwingt. Ich sehe ihn des Abends mit seinen Freunden, die nicht alle in so ärmlichen Verhältnissen leben, in der Wirtschaft sitzen, Bier trinken und Reden schwingen. Natürlich lädt man ihn ein, wofür er ab und zu eine Kostprobe seiner Poesie preisgibt. Mittlerweile bin ich regelrecht verliebt in dieses Bild, habe aber gelesen, dass es bei seiner ersten Vorstellung in der Öffentlichkeit 1839 in München erheblicher Kritik ausgesetzt war. Man hat die Ironie hinter dem Bild zwar verstanden, aber für völlig unangemessen gehalten. Die Gesellschaft dachte wohl, Spitzweg wollte die Verhältnisse anprangern, unter denen die Dichter und andere Künstler damals leben mussten und sich entsprechend nur schwer verwirklichen konnten. Eine sozialkritische Betrachtungsweise dieses Bildes verändert seinen ungewöhnlichen Biedermeier-Charme nicht; aus ihm sprechen der geniale Humor und die wunderbare Phantasie eines begabten Malers. Wäre das denn nicht auch genug, oder müssen wir uns jetzt in ausschweifenden Diskursen über die vermeintliche Bedeutung des Flohs ergehen?
Bleiben Sie stets neugierig… und durstig!