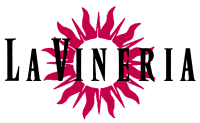Jahrzehntelang das Non-Plus-Ultra des heimischen Musikgenusses: die Langspielplatte (Bild von Pexels auf Pixabay)
Die Schallplatte war meine erste Begegnung mit konservierter Musik. Meine Tante war nämlich im Besitz eines Vorkriegsplattenspielers, eines sog. Grammophons, und in den Kindertagen durfte ich nach den langweiligen Kaffekränzchen mich in ihr Schlafzimmer zurückziehen und damit Musik hören. Damals habe ich Bekanntschaft gemacht mit Rudi Schuricke und den Caprifischern sowie mit Zarah Leander, die immer noch wusste, dass einmal ein Wunder geschehen würde – obwohl es schon längst zu spät war. Aber das wirkliche Faszinosum waren die gerillten Schelllackplatten mit den exotischen Namen „Decca“, „Parlophone“ oder „His Masters Voice“, dazu der magische Arm mit der Membran und der Nadel, der sich auf der drehenden Platte langsam nach innen bewegte. Meinen ersten eigenen Plattenspieler bekam ich mit 13 Jahren. Er sah aus wie eine Hutschachtel und konnte die 45er sowie die großen 33er-Langspielplatten abspielen. Mit diesem Gerät der Firma „Philips“ und Mozarts kleiner Nachtmusik begann meine Liebe zur klassischen Musik.
Die Technik hinter der Akustik entwickelte sich in den 60iger Jahren des vorigen Jahrhunderts in atemberaubender Geschwindigkeit. Die Stereophonie wurde zum Zauberwort und man brauchte jetzt einen neuen Plattenspieler mit der entsprechenden Ausrüstung und zwei möglichst große Lautsprecher. Jetzt hörte man buchstäblich die Geigen links, die Bratschen in der Mitte und die Celli und Bässe rechts sitzen. Die „Stereoanlage“ war geboren und wurde bald zum Fetisch einer ganzen Gesellschaft. Ob Klassik oder Pop, das räumliche Klangerlebnis begeisterte alle Altersklassen und sozialen Schichten. Bis auf die später im Lebenszyklus des Tonträgers auftretenden und unvermeidlichen Kratzer auf den Rillen erschien mir eine neue Langspielplatte zur damaligen Zeit klanglich absolut perfekt zu sein. Sie war auch perfekt, wie ich seinerzeit bei einem Besuch in den Münchner Aufnahmestudios der „Deutschen Grammophongesellschaft“ erfahren konnte. Wenn der Künstler einen Ton nicht korrekt traf, sei es mit der Stimme oder einem Instrument, war das für die Techniker vor Ort überhaupt kein Problem: man schnitt die unerwünschte Sequenz einfach heraus und fügte den elektronisch erzeugten Ersatz ein. Die physikalische Analyse der jeweiligen Töne, einschließlich aller individuellen Eigenheiten wie Klangfarbe und Stimmung, kann so genau sein, dass selbst die Musikexperten den technischen Eingriff nicht bemerken können. Das Ergebnis ist für Musikfreunde durchaus ambivalent: Die Perfektionisten feiern die Brillanz und Strahlkraft dieser Aufnahmen, während die Skeptiker mit Schrecken feststellen, dass hier ein Standard von Perfektion geschaffen wurde, der im Konzertsaal nie zu erreichen war.
Ich nehme an, dass jeder der selbst Musik macht, gelegentlich frustriert die Aufnahmen der großen Stars aus dem CD-Player holt und mit dem Gedanken ins Etui zurücksteckt „das schaffe ich so nie“. Dies weist auf einen Kritik-Punkt, der letztlich die ganze Musikindustrie, einschließlich des Publikums, betrifft, nämlich der vom Kommerz getriebene, ständige Wunsch auch unter den Musikern, wie bei den Tennisspielern, eine Art von „Welt-Ranking“ einzuführen. Wer ist der Beste? Wen muss man gehört haben? Welche Namen muss man erwähnen um den Eindruck zu erwecken ein Insider zu sein? Unter den musikalischen Publikumslieblingen herrscht ein unbarmherziger Wettbewerb, der, wie wir gelegentlich aus der Presse erfahren, sogar mit harten Bandagen ausgetragen wird. Für mich persönlich sind Begeisterung und Leidenschaft eines Musikers das einzig Ausschlaggebende für meine persönliche Freude an seiner Darbietung. Das betrifft Solisten, den Dirigenten und die Mitglieder des Orchesters gleichermaßen, egal welch illustre Namen sie tragen oder nicht. „Gefühl ist alles; Name ist Schall und Rauch“ sagt Faust im gleichnamigen Drama, welch andere Beschreibung würde die Musik-Industrie besser charakterisieren?
Vor etwas mehr als einem Jahrzehnt begann eine neue Ära für die Musikfreunde in aller Welt: das sog. „Streaming“ von Musik. Rein technisch gesehen handelt es sich dabei um die kurzzeitige Übertragung von Audio- oder Videodateien auf Computer bzw. Smart-Phones/tablets oder internetfähige Fernsehgeräte. Anders als beim sog. „Download“ werden diese Dateien nicht auf dem heimischen Gerät gespeichert, belegen also keinen Speicherplatz. Einen ganz besonderen Platz nimmt dabei das “Live-Streaming“, der direkt übertragene Mitschnitt eines musikalischen Ereignisses, ein. Vorausgesetzt die Fähigkeiten der verfügbaren Audio- bzw. Videotechnik reichen aus, dann kann eine derartige Übertragung z.B. eines Konzerts oder einer Oper zu einem großen und sehr besonderen Kunsterlebnis werden. Ähnlich wie im Konzertsaal wird der Zuhörer direkter Zeuge des Schaffensprozesses der Musiker, aber anders als im Zuschauerraum kann man im Live-Stream durch die Kameraführung den individuellen Ausdruck eines einzelnen Instrumentalisten oder Sängers bzw. einer Sängerin in der Vielfalt des gesamten Orchesters oder Ensembles beobachten. Die Musik bekommt dadurch eine unverhoffte, physische Nähe und wird zum Erlebnis der besonderen Art. Freilich, ein Team von Kameraleuten trifft die Auswahl dessen was wir am Bildschirm „von der Musik zu sehen“ bekommen und man kann mit zunehmender Erfahrung die wirklichen Könner der Musikübertragung von den musikalisch eher Unbedarften unterscheiden. Ich persönlich finde, dass in Zeiten der Corona-Pandemie die Direktübertragung von Konzerten oder Opern bzw. deren Aufzeichnung, die nächstbeste Alternative zur Anwesenheit im Konzertsaal bzw. im Opernhaus darstellt.
Bleiben Sie stets neugierig …und durstig!