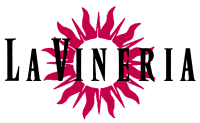Als Prozess der „Delokalisation“ kann man jenes Phänomen bezeichnen, was die wirtschaftlichen und kulturellen Bindungen des Weins an einen bestimmten Wohnort, bzw. an eine umschriebene Region aufgehoben hat, d.h. der Wein wird auch an anderen Orten als seiner geographischen Heimat konsumiert. In gewissem Rahmen gab es dieses Phänomen schon seit den Zeiten der Römer, Wein wurde bekanntlich in Amphoren aus Kolonien wie Spanien ins Mutterland verschifft. Nicht weinbauende Nationen wie die Engländer und die Holländer stillten ihre Bedürfnisse schon frühzeitig durch den Import aus den Nachbarländern. Voraussetzung für diese Entwicklung war allerdings, daß der Wein einigermaßen haltbar und damit reisefähig gemacht werden konnte. Um dies zu erreichen, experimentierten pfiffige Winzer schon seit Jahrtausenden und die von ihnen entwickelten Methoden würden ein eigenes Buch füllen. So richtig glücken wollte es allerdings erst, als Louis Pasteur die Bedeutung der Mikroorganismen für die Gärung und für die Haltbarkeit des Weins entdeckt und entsprechende hygienische Maßnahmen zu deren Kontrolle erforscht und umgesetzt hatte.
Gemessen an den Zeitläufen der Geschichte des Weins gibt es den Weingenuß, wie ihn heute die Weinfreunde rund um den Globus zelebrieren, erst seit relativ kurzer Zeit. Die wichtigste Voraussetzung dafür war nämlich die Möglichkeit einer Flaschenabfüllung und ihr effektiver Verschluß. Kork als Verschluß von Gebinden, die Wein enthalten, ist eine uralte Angelegenheit. Schon in der Antike wurden die Amphoren nach der Gärung zum Transport mit Kork und Teer verschlossen. Im Mittelalter ist diese Kunst dann wieder in Vergessenheit geraten. Die meisten Illustrationen zeigen, daß die Spundlöcher der Fässer – damals die einzigen Aufbewahrungsbehälter für Wein – mit Holzbolzen und ggf. einem dazwischenliegenden Tuch, verschlossen wurden. Ein Grund für das Verschwinden des Korkens war seine geringe Verfügbarkeit. Die einzigen, nennenswerten Korkeichenwälder lagen nämlich auf der iberischen Halbinsel und dort herrschten die Mauren, denen man nur wenige Waren im Tausch für Kork anbieten konnte. Im 17. Jahrhundert begann langsam der Siegeszug der Glasflasche und mit ihr auch der des Korks. Zunächst wurde der Kork nur teilweise in die Flasche gedrückt, so daß ein natürlicher Griff zum Öffnen vorhanden blieb, so etwa wie heute noch beim Sekt oder Champagner. Erst am Beginn des 18. Jahrhunderts, als der Korkenzieher erfunden war, wurden die Korken komplett in den Flaschenhals versenkt. Damit war ein Verschluss geboren, der erstmals eine längere „Flaschenreife“ des Weins zuliess und der die Verschiffung des immer gleichen Weins einer bestimmten Lage und eines bestimmten Jahrganges über die ganze Welt ermöglichte – eine unabdingbare Voraussetzung für die spätere Globalisierung. Die Entwicklung des Korken als Flaschenverschluß ist ein treffenes Beispiel dafür, wie eine neue Technologie zu einem ganz neuen, bis dato unbekannten Genußerlebnis und, bis zu einem gewissen Grade, auch zu einer Veränderung der Weintrinker-Soziologie, führen konnte.
Wen wundert es, daß bei diesem gewaltigen historischen Hintergrund von vielen Weinfreunden heute jede Art von Alternative zum Korken als Weinflaschenverschluss abgelehnt wird? Die Diskussion ist in vollem Gange, und wird teilweise sehr emotional geführt, ob man den klassischen Korken, wegen seiner limitierten Verfügbarkeit und seiner häufig inadäquaten Qualität (Korkschmecker!) nicht durch Schraubverschlüsse, Kronkorken oder Glasstopfen ersetzten sollte. Der Korken sei, trotz seiner Mängel, ein Stück Weinkultur, auf das man nicht verzichten könne, ohne den vollen Genuß des Weines einzubüßen, argumentieren die Traditionalisten. Und wie wird sich ein Wein in der alternativ verschlossenen Flasche entwickeln? Bedenken gibt es zu Hauf, ob sie sich aber bewahrheiten wird die Zukunft zeigen, denn ein paar progressive Winzer haben die ersten Schritte zu neuen Flaschenverschlüssen für ihre Weine bereits vollzogen.
Die Erweiterung der interkulturellen Beziehungen und die Kenntnisse von anderen Ländern durch internationale Arbeitsverhältnisse oder durch den Tourismus haben heute eine bis dato nie gekannte gesellschaftliche Mobilität geschaffen. Hinzu kommt eine, ebenfalls über kulturelle Grenzen hinweg wirkende Werbeindustrie, die gelernt hat ihre Zielgruppen auf sehr subtile Weise anzusprechen. Für die Weinkultur bedeutete dies weltweit eine zunehmend große Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem und gleichzeitig – so merkwürdig dies zunächst klingen mag – eine immense Vereinheitlichung des Geschmacks der Weintrinker. Die Exporteure versuchten nämlich schon immer mit den ausgeführten Weinen auch den Geschmack der Käufer in der Fremde irgentwie zu treffen. Symptomatisch dafür waren z. B. die Verhältnisse in Chile. Moderner chilenischer Wein ist mittlerweile in der ganzen Welt zu erwerben und beliebt, weil er einen verkaufsträchtigen, internationalen Stil trifft aber in seiner Heimat wurden noch vielfach ganz traditionelle, leicht oxydierte Weine bevorzugt, die sonst niemand mochte. Hier hatte sich eine Exportindustrie völlig von der althergebrachten, heimischen Industrie losgelöst und zeigte die damit verbundenen Probleme sehr deutlich, nämlich den Zwang zur Uniformität eines internationalen Produktes. Stuart Pigott nennt dies in seinem kritischen Buch „Schöne neue Weinwelt“ die „Infantilisierung unseres Geschmacks“, weil die internationalen Weingeniesser heutzutage, wie Kinder, auf die einfachen, süßen, unkomplizierten und spannungslosen Gerüche und Geschmäcker abfahren. Großproduzenten in fast allen Weinbauländern sind inzwischen völlig von den globalen Märkten abhängig und müssen sie eben deswegen mit allgemein verständlichen, d.h. von der jeweiligen spezifischen Weinkultur unabhängigen, Produkten bedienen. Der wirtschaftliche Faktor, und nicht mehr die geographische Gegebenheit, ist vielfach zum Maß der Persönlichkeit und des Charakters eines Weins geworden. Gelegentlich wird die Debatte um den Charakter der Weine reduziert auf die schlagwortartigen Antipoden „Neue“ gegen „Alte“ Welt. Der Begriff der „Neuen Welt“ steht dabei für die Technologisierung der Vinifikation. „High Tec“-Weine sind entpersonalisiert, der alte Winzer mit dem braungebrannten Gesicht und der Baskenmütze, der noch in gewisser Weise den Landwirt verkörpert, ist zum „Winemaker“, zum Weinmacher mit akademischer Ausbildung geworden, der komplizierte Maschinen und elektronische Schaltkreise bedienen muß. Während sich der Winzer mit dem Duft von Most und Kellerschimmel umgibt, gibt es im High Tec-Sektor, der Welt der „Weinmacher“, keine Gerüche mehr. Gelegentlich findet man, daß sich auch die Architektur der Kellereien den jeweiligen Weinstilen angepasst hat. Ästhetisch beeindruckende Gebäude verraten den modernen Geist. Das „Was-ist-besser-für-den-Wein“ steht wie ein imaginäres, riesiges Fragezeichen neben diesen Bildern. Einiges wirkt tatsächlich befremdend. Was hat ein futuristisches, titanverkleidetes Gebäude des Stararchitekten Frank Ghery in der lieblichen Landschaft der Rioja zu suchen? Das mag sich mancher Besucher der Kellerei des Marqués de Riscal in Elciego fragen.
In Gesprächen mit australischen oder kalifornischen Winzern bekam ich öfter das Gefühl als tobe um den Wein ein regelrechter „Kulturkampf“. Auf der einen Seite stehen die Verfechter des reproduzierbaren Qualitätsproduktes, dem alle verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse und Methoden zu dienen haben. Die Kontrahenten sind die Verfechter des landwirtschaftlich gefertigten Weines, der seine Individualität aus den klimatischen Jahrgangsschwankungen und aus der Winzertradition bezieht. Es ist schlichtweg unmöglich eine Lösung dieses „Konfliktes“ zu finden, den man als Konflikt zwischen industrieller und landwirtschaftlicher Weinkultur definieren könnte, und in dem beide Parteien sicher vernünftige Argumente haben. Wie immer in solchen Fällen führt ein Mittelweg vermutlich zum gemeinsamen Ziel, nämlich charaktervolle Weine zu produzieren. Mir persönlich gefällt die englische Beschreibung des Winzers als „wine-farmer“ sehr gut. Ich habe sie vielfach in Südafrika gehört, einem Land mit langer Weinbautradition und heute aber vom Weinwstil aus gesehen eher der „Neuen Welt“ zurechenbar.
Reinhard Löwenstein, selbst ein Winzer, schrieb einmal in der „Frankfurter Allgemeinen“: „Der Wein ist angekommen in der modernen Industriegesellschaft. Die Entwicklung, die sich bei anderen Getränken wie Fruchtsaft und Bier schon vor vielen Jahren vollzog, hat den Wein erreicht. Food Design statt Vinifikation. Nur – wo ist das Problem? Wen stört es, wenn Wein billiger wird und besser schmeckt?“ frägt er. Offenbar nur wenige. Der zweite Demokratisierungsprozess in der Weingeschichte, der mit dem endgültigen gesellschaftlichen Sieg der Bourgeosie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts einherging, bewirkte die völlige Globalisierung des Weins. Diese Entwicklung wird von vielen, auch sehr seriösen, Weintrinkern stürmisch gefeiert. „Noch nie hatten wir ein so vielfältiges Angebot von so guten Weinen wie in unseren Tagen!“ rufen sie euphorisch aus und quälen sich dann in manchen Gourmettempeln durch Weinkarten, deren schieres Gewicht die physische Kraft sie in der Hand zu halten übersteigt. Es ist der Sieg der städtischen Kultur. Die Ernährungsweise und Trinkkultur der Städter hat die der ländlichen Bevölkerung endgültig abgelöst. Es scheint als sei dies die Krönung eines uralten Traums der Menschheit. Was sich einst nur Fürsten leisten konnten, ist mittlerweile zur allgemein verfügbaren, ja zur Kaufhaus-Ware geworden.
Prompt hat auch die Gegenbewegung eingesetzt. Das latente Unbehagen, das der uniforme, städtische Lebensraum bei den Menschen auslöst, hat vielerorts zu einer „Sehnsucht nach dem Lande“ und nach der „verlorenen“ bäuerlichen Welt geführt. Nur eines darf man dabei nicht vergessen, nämlich, daß diese Sehnsucht ausschliesslich auf der Basis städtischer Wertmaßstäbe aufbaut. Niemand möchte wirklich zurück in vorindustrielle Verhältnisse, denn nur eine sehr reiche Gesellschaft kann es sich erlauben von der Armut und Einfachheit zu schwärmen. Diese Romantik hat sich nicht nur über die Nahrungsmittelindustrie ausgebreitet und damit den Öko- und Bio-Bauern ungeahnten Wohlstand gebracht, sondern sie hat auch einen Teil der Weintrinker erfasst. Hier heißt das Zauberwort „terroir“. Für den oben erwähnten Löwenstein liegt die Zukunft des Weins genau dort. Das „terroir“ ist die oft mystifizierte Summe von Böden, Mikroklima und Rebsorten, die nach landläufiger Meinung den besonderen Charakter eines Weins ausmachen. Der Konsument sollte das „terroir“ am Gaumen spüren und nachvollziehen können. Dies ist, wenn überhaupt, natürlich nur in sehr beschränktem Umfang möglich. Der Geniesser muß nicht nur die Gegend und die Jahrgangsschwankungen eines Weins sondern insbesondere auch die Eigenarten des jeweiligen Winzers und seines Kellers gut kennen um ein „terroir“ wirklich erriechen und erschmecken zu können. Das können die erfahrenen Winzer selbst in ihrem eigenen Gebiet vielleicht gerade mit Mühe, aber der global orientierte Weinfreund ist in jedem Falle völlig überfordert.
Nach welchen Kriterien soll er die ihm vielleicht völlig unbekannten „terroirs“ von Stellenbosch oder dem Maipo-Tal erkennen? Häufig simplifiziert daher der bewusste Weintrinker den umfassenden Begriff des „terroir“ zu „Mineralität“, d.h. wenn ein Wein das Mineralische eines Bodens schmecken lässt, zeigt er „terroir“, ein Begriff der dann in dieser verkürzten Form nicht mehr seinem ursprünglichen Inhalt entspricht. In Wirklichkeit, scheint mir, drückt der Begriff „terroir“ etwas Metaphysisches aus. Das Terroir ist der große Traum von der Individualität des Menschen in der Massengesellschaft. Terroir hat natürlich auch etwas mit der „Typizität“ eines Weines zu tun. Was aber ist das nun schon wieder? Selbstverständlich weiß niemand wie Schiefer-, Lehm oder Lössböden bzw. ein verregneter Sommer schmecken. Es scheint aber als hätten Generationen von Weintrinkern das „Typische“ einer Reblage in das kollektive Gedächtnis eingeprägt. Nur so ist zu verstehen, daß „offizielle“ Verkoster in Weingegenden mit garantierter Herkunftsbezeichnung die Typizität eines Weines aus diesem Gebiet bestätigen bzw. ablehnen können. Hier ist nicht der Platz die Diskussion ums Terroir zu Ende zu führen, geben wir uns vielleicht mit der „Typizität“ als hinreichende Definition eines lokalen Charakters zufrieden. Im Gegensatz zur eingangs erwähnten Delokalisation des Weines, die in seiner Globalisierung mündete kann man als Gegenbewegung von einer „Patrimonialisierung“, d.h. von der Wiederbesinnung auf der Väter Erbe beim Weinbau, sprechen. Dabei ist unter Erbe tatsächlich die Parzelle zu verstehen. Hier ist für den Weinfreund allerdings äusserste Vorsicht geboten, denn längst haben die Marketingexperten grosser Getränkekonzerne entdeckt, daß man Kenner ködern kann indem man ihnen eine Geschichte und eine „alteingesessene“ Familie, die sich um das Erbe der Väter und Großväter Sorgen macht, vorgaukelt. Vergilbte Fotos traditioneller Vinifikationen mit Mauleseln und schönen Landschaften vermitteln das Image der guten alten Zeit, in der der Wein noch ganz „natürlich“ war. Der Konsument nimmt unwissend mit einer Authentizität vorlieb, die es in Wirklichkeit in der angepriesenen Form garnicht gibt. Sein Weinerlebnis bleibt in gewissem Sinne ein „Pseudoerlebnis“. Es gibt keine sichere Methode mit der man derartige Machenschaften erkennen kann. Skepsis ist immer dann angebracht, wenn hinter einem sehr individuell anmutenden Produkt ein riesiges, multinationales Unternehmen steht, oder wenn sonstwie die Plausibilität des Dargestellten infrage gestellt werden muß.
Die „Terroiristen“ à la Löwenstein fordern im Wein nicht das Perfekte, sondern die Ecken und Kanten, das an ihren Gaumen „Authentische“ und „Komplexe“. Dem Kritiker sei erlaubt festzustellen, daß auch die geübteste Zunge gelegentlich einen wirklichen Fehler im Wein dem „terroir“ zurechnet. Das klassische Beispiel sind die ubiquitären Infektionen mit Brettanomyces, einem Pilz, der die unglaublichsten, und nicht immer schlechten, Aromen in den Wein bringt. Darin liegt die ganze Crux des Terroirgedankens. „Terroir“ auf der Zunge ist kaum definierbar. Es ist, wie bereits erwähnt, ein metaphysischer Begriff, und zwar im Sinne des letztlich nicht Erfahrbaren und nicht Erkennbaren. Der aufgeschlossene Weintrinker braucht ihn auch eigentlich garnicht. Manches Gedankengut der „Terroiristen“ liegt in der Nähe des ökologischen Weinbaus und dennoch sind diese beiden Richtungen nicht mit einander zu verwechseln. Gemein ist ihnen jedoch gelegentlich die Emotionalität, mit der sie jeweils gegenüber ihren vermeintlichen Gegnern verteidigt werden. Der wahre Geniesser ist immer ein sehr toleranter Mensch, denn er hat längst gelernt, daß seine Sinneswahrnehmungen äusserst subjektiv sind und diese Subjektivität gesteht er natürlich allen anderen Menschen in gleichem Maße zu.
Die Frage wer denn die „Terroiristen“ innerhalb der Soziologie der Weintrinker eigentlich sind, ist, auf den ersten Blick, nicht einfach zu beantworten. Terroir hat etwas elitäres und überhebliches, so jedenfalls sehen es manche Weinschriftsteller in der Neuen Welt. Ich habe einen Kritiker der „terroir“-Vorstellung fragen gehört: „wer will denn eigentlich diese teuren und unverständlichen Weine, zu denen man sich erst einen akademischen Vortrag anhören muß, bevor man das Genußvolle erkennt“? Andererseits fragen die Verfechter gerade dieser Weine: „wer möchte denn die gemachte Wein-Limonade der Großproduzenten aus Europa und Übersee trinken“?