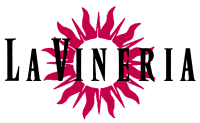Unser aller Leben wird mehr oder weniger stark von Konventionen geregelt und beeinflußt. Jede soziale Gruppe hat ihre Verhaltensregeln, die auf einer meist stillschweigenden Übereinkunft unter den Gruppenmitgliedern basieren. Die Hintergründe dieser Regeln sind häufig gemeinsame Traditionen oder schlichtweg die sich über lange Zeit herausgebildete Gewohnheit. Konventionen haben den großen Vorteil, daß sie denen, die sie als soziale Umgangsformen akzeptieren, das Nachdenken ersparen und sie vor groben gesellschaftlichen Fehlern bewahren. Was solche Konventionen tatsächlich sind, kann man auch ganz gut bei den sogenannten „Grundregeln“ der Kombination von Wein und Essen studieren. Seit es eine gehobene Küchenkultur gibt gilt der Satz „zu weißem Fleisch und Fisch trinkt man Weißwein“, bzw. seine Umkehr „zu dunklem Fleisch und Wild trinkt man Rotwein“. Nur wenige Menschen brechen in unserem Kulturkreis gerne mit diesen Konventionen, denn auch für die meisten Gourments gilt das alte Sprichwort „Was der Bauer nicht kennt, das mag er nicht“, d.h. ein Abweichen von der Regel steht meist ausser Frage. Wenn die Ratlosigkeit beim Zusammenfügen von Essen und Wein ein Höchstmaß erreicht, greifen ganz Wagemutige gelegentlich zum Champagner oder zum Roséwein – aber das sind die wirklichen Ausnahmen. Daß es auch anders gehen kann beschrieb schon Marcel Proust in seinem Klassiker „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“. Bei einem großbürgerlichen Mahl um die Wende zum 20. Jahrhundert, wurde zu einer Barbe mit „Sauce blanche“ ein „ganz aussergewöhnlicher Léoville“, also ein Rotwein aus dem Medoc, gereicht. Man sieht, daß ein gelungener Bruch von Konventionen offenbar auch schon früher seinen sinnlichen Reiz hatte.
In den Vereinigten Staaten hat man die Geschmackserfahrungen von Weintrinkern untersucht und dabei festgestellt, daß die genannten Grundregeln überhaupt keinen physiologischen Hintergrund haben. Es stellte sich heraus, daß ein weißer (= weiß gekelterter) Zinfandel den Studienteilnehmern zum Rindersteak deutlich besser geschmeckt hat als ein starker Cabernet Sauvignon. Der gleiche Cabernet passte aber hervorragend zu einer feinen Seezunge. Die Studie hat deutlich gemacht, daß sehr oft die persönlichen Wertvorstellungen beim Essen und Trinken die tatsächliche geschmackliche Erfahrung unterdrücken. Diejenigen, die sich vom Diktat ihrer Geschmackskonventionen lösen konnten, berichteten übereinstimmend, daß der Fisch vom Cabernet Sauvignon nicht erschlagen wurde, sondern im Gegenteil, feiner und sogar süßer schmeckte. Nun muß man aufpassen, daß das Brechen der Grundregeln nicht selbst zu einer Mode wird. Es gibt genügend Hobbyköche, und auch Gastronomen, die glauben eine unkonventionelle Kombination von Essen und Trinken sei der Zeitgeist. Daß das Ergebnis vielleicht unharmonisch und für den Gaumen wenig befriedigend ist, stört sie dabei weniger, denn sie sehen es als ein notwendiges Opfer an den gastronomischen Fortschritt. Diese Experimentatoren haben leider auch unter den wirklichen Weinfreunden und Sommeliers viele Anhänger, die deren sensorischen Kapriolen vehement verteidigen. Es fällt in der Tat gelegentlich schwer selbst von den eingefahrenen kulinarischen Vorstellungen zu lassen und sich etwas Neuem zu öffnen, denn Geschmack ist im Grunde eine äusserst konservative Angelegenheit.
Wer bestimmt eigentlich welcher Wein getrunken wird? Unzweifelhaft ist auch der Weingenuß Moden unterworfen. Moden haben nichts mit dem Stil einer Epoche zu tun sondern sie reflektieren den sich schnell wandelnden Geschmack in Kultur, Zivilisation oder Lebensweise. Moden sind definitionsgemäß kurzfristig, unvorhersagbar und scheinbar willkürlich verursacht. Gelegentlich werden sie von Produzenten oder deren Interessenverbänden gemacht und gesteuert. Im Gegensatz zu den relativ dauerhaften sozialen Verhaltensweisen, die die Essens- und Trinkgewohnheiten einer Gesellschaft regeln, kommen und gehen die Moden, die bestimmte Gerichte oder Weine favorisieren. Die plötzliche Popularität des „Prosecco“ in den 90-iger Jahren des 20. Jahrhunderts und die des „Beaujolais Nouveau“ ein Jahrzehnt vorher, sind gute Beispiele für Moden. In beiden Fällen standen starke Marketing-Organisationen hinter dem Boom. Eines ist sicher: es waren nicht die ersten Weingeschmacksmoden. Aus dem 13. Jahrhundert ist uns ein sehr humorvoller Dreizeiler überliefert, der sich auf eine Weinmode jener Zeit bezieht. Er stammt von Cecco Angiolieri, einem bedeutenden italienischen Dichter aus Siena:
Und ich möchte nur griechischen Wein und Vernaccia,
Lateinischer Wein ist scheußlicher
Als meine Frau, wenn sie mit mir zankt.
Damals war Wein aus Griechenland, bzw. aus Kreta oder Zypern, der allerhöchste Luxus. Aber auch der weiße Vernaccia aus San Giminiano muß schon jene Rasse und Substanz gehabt haben, die wir heute noch verehren. Nicht ohne Grund war er auch der Lieblingswein Michelangelos! Über die Tatsache, daß Weintrinker immer mehr jüngere Weine bevorzugen haben wir bereits im Zusammenhang mit der Altersstruktur der Konsumenten gesprochen.
Die große Veränderung bei der Wahrnehmung der Weine in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war das Auftreten der Weinkritiker, der Gurus des Geruchs- und Geschackssinnes. Wer heute von maßgeblichen Weinkritikern redet, dem fällt unweigerlich der Name Robert Parker ein. Er scheint in seiner Machtfülle, jedenfalls was den sensorischen Wert eines Weines angeht, fast einzigartig zu sein. Aber auch er hat Vorgänger und der vielleicht bedeutendste war der Römer Plinius der Ältere im ersten Jahrhundert n.Chr. Im Gegensatz zu seinem amerikanischen Epigonen zweitausend Jahre später, war Plinius ein universaler Geist. Er hat als erster versucht die Erscheinungen der Natur in einer überlegten Ordnung darzustellen. Wen wundert es, daß er dabei in seiner „Naturgeschichte“ auch auf den Wein zu sprechen kam. Er bewertete als erster in der Geschichte der Weinkritiker nach einem 100-Punkte-Schema. Der Caecuber-Wein erhielt seinerzeit 95 und der Falerner 90 Punkte. Natürlich hatte Plinius gegenüber unseren Weinkritikern heute ein leichtes Spiel. Es gab im römischen Reich vielleicht drei Dutzend Weine, die es wert waren beschrieben und bewertet zu werden. Dies ist in unseren Tagen ganz anders. Robert Parker bewertet an die 10.000 Weine im Jahr, verkostet häufig an allen sieben Tagen der Woche und das während etwa 9 Monaten im Jahr. Die meisten Notizen stammen aus Parkers eigener Feder, da er die Weine auch selbst bei sich zuhause in Maryland probiert. Er hat noch nie als Juror an öffentlichen Weinwettbewerben teilgenommen und bislang ist es, trotz vieler Versuche neidischer Konkurrenten, noch nicht gelungen ihm Geschäftsabhängigkeiten zu Weinproduzenten nachzuweisen. Das Geheimnis seines Erfolges liegt ganz sicher in der präzisen, schnörkellosen Art seiner Weinbeschreibungen und an der genialen Einfachheit und Verständlichkeit des von ihm wiederentdeckten 100-Punkte-Systems. Parker lässt nie die Frage offen ob der Wein gut oder schlecht sei. Seine Beurteilungen sind eindeutig und für jeden verständlich.
Die Sinnesphysiologie, d.h. die Lehre von den körperlichen Wahrnehmungen, unterscheidet zwischen dem primären und dem erworbenen Geschmack. Das positive Geschmacksempfinden beim Weintrinken ist, wie beim Kaffee, dem Tabak, dem Kaviar und unendlich vielen anderen Genußmitteln, erworben. „Acquired taste“ nennt man dies in der englischen Fachsprache. Wie bei vielen Geschmäckern, die der Mensch erst im Erwachsenenalter so richtig zu schätzen beginnt, bedarf es auch beim Wein sehr viel Übung und Wissen um in die Höhen vorzudringen. Und wie kommt man dazu? Nur durch Probieren. Sehr oft sind Geschmackserlebnisse und Düfte mit Situatuationen verbunden in denen wir glücklich oder unglücklich gewesen sind während wir dem Geruch ausgesetzt waren. Ausserdem können die persönlichen Gefühls- und Stimmungszustände das Duft- und Geschmackserlebnis wesentlich beeinflussen. Jedem Weintrinker sind diese Zusammenhänge bekannt. Man muß sich, gerade beim Geniessen von Wein, immer über die enorme Subjektivität von Geruchs- und Geschmackserlebnissen bewusst sein. Dann wird man auch verstehen, daß selbst die „Weinpäpste“, die ja sicher auch Stimmungen unterworfen sind, nicht unfehlbar sein können. Welch eine Welle von Entrüstung hat Robert Parker hervorgerufen, als er wagte deutsche Riesling-Weine in sein 100 Punkte-Schema zu pressen! Der große Kenner von Bordeaux, Burgund oder Kalifornien hat daran Schiffbruch erlitten, weil er die Weine und ihre Hintergründe nicht kannte. Dies ist aber ganz besonders wichtig für eine der wesentlichen Funktionen des Weinkritikers, nämlich die „Prospektion“. Er sollte die Qualität eines Weines prospektiv beurteilen, d.h. er muß eine Ahnung haben wie sich der Wein entwickeln wird. Die Trinkqualität eines Weines ist an einem bestimmten Zeitpunkt nicht absolut objektiv. Viele Kreszenzen erreichen erst nach einer längeren Lagerzeit ihre Trinkreife, ein Umstand der sich zum Zeitpunkt des Genußes einem ungeübten Weintrinker nicht unbedingt zu offenbaren braucht. Der Kritiker aber muß das Potential des Weins aus seinem Erfahrungsschatz beurteilen können. Damit legt er auch in gewissem Sinne den Wert eines Weines fest.
Noch ein abschliessender Gedanke zur „Benotung“ von Weinen. Mir ist aufgefallen, daß es auch dabei kulturelle Unterschiede gibt. Das 100-Punkte-System ist dem amerikanischen Schulsystem entliehen und wird daher auch vorwiegend in der angelsächsischen Weinszene angewandt. Es suggeriert soetwas wie Prozente. 100 Prozent bzw. Punkte ist das absolut perfekte, es kann definitionsgemäß nicht verbessert werden. Das 20-Punkte-System entstammt dem französischen Schulbetrieb und wird vornehmlich in Kontinentaleuropa angewandt. In Deutschland benotet man ja auffallend gerne nach einem 6- oder 5-Punkte- bzw. Sterne-Schema, umgekehrt analog den Schulnoten. Diese Einstufungen suggerieren bei den Konsumenten in den entsprechenden Ländern eine objektive Beurteilung der „Leistung“ des Weins, etwa wie der Klassenlehrer die Leistungen seiner Schüler objektiv dokumentiert. Übereifrige reden dann tatsächlich auch gerne von einem „Preis-/Leistungsverhältnis“ beim Wein. Mir scheint aber, daß dieser Vergleich hinkt. Natürlich ist es möglich die Leistung eines Schülers bei einer Mathematikarbeit objektiv zu beurteilen, was aber ist mit einem Aufsatz über ein philisophisches Thema? Wein ist sicher eher mit Philosophie als mit Mathematik zu vergleichen. Und noch etwas kommt hinzu: der Modegeschmack, dem natürlich auch der Kritiker unterworfen ist. Es ist ja kein Geheimnis, welche Kriterien z.B. ein Rotwein heute erfüllen muß um mit Sicherheit hohe Noten bei Verkostungen zu erreichen: tiefe Farbe, intensive Vanille oder vergleichbare Würzaromen vom Holz, samtige Struktur am Gaumen und einen soliden Tanninfonds. Wozu so ein Wein-Protz dann getrunken werden soll, bleibt offen und interessiert den Kritiker auch garnicht, denn er verkostet ja auf leeren Magen und üblicherweise in einem sonst völlig genußlosen Ambiente. Mein persönliches Fazit aus diesen Überlegungen ist, daß die numerische Beurteilung von Weinen nach Schulnoten ein eigentlich nicht zulässiges Verfahren ist, denn es stellt eine ungehörige Simplifizierung höchst komplexer Geschmacks- sowie Geruchempfindungen und sehr individueller Assoziationen dar.
Die Frage wer den Geschmack der Weintrinker eigentlich bestimmt ist, trotz des Hinweises auf Robert Parker, noch weitgehend unbeantwortet. Wie bei allen Moden, liegt es nahe die s.g. „Medien“ dafür mitverantwortlich zu machen. Weinzeitschriften erleben z.Z. einen Boom sondergleichen. Es gibt solche, die sich mit eher technischen Informationen an den Handel wenden und solche die für die Endverbraucher, also den Weinkonsumenten, gemacht sind. Ihre Bedeutung als Meinungsbildner und Modemacher ist wohl eher gering. Sie sind mehr die Verkaufsgehilfen der Händler und Winzer, die bestehende Trends aufgreifen und beschreiben.
Längst ist das Thema Wein von solch universeller Bedeutung, daß auch die Tageszeitungen und Wochenzeitschriften sich ihm nicht mehr entziehen können. Regelmässige Glossen in den regionalen und überregionalen Blättern, ja ganze Sonderbeilagen, sollen den Wissenshunger der ständig zunehmenden Weinfreunde stillen. Es gibt keine Statistik über die kommerzielle Bedeutung des Weinjournalismus, aber aus der Tatsache, daß alle großen Kellereien und Weinhändler über Presseabteilungen und entsprechende Werbebudgets verfügen, kann man unschwer die Signifikanz dieser Branche ablesen. Vergessen wir nicht, daß nicht jede Flasche eines großen Weins auch getrunken wird. Längst ist das Objekt der sinnlichen Begierde auch zu einem Objekt ökonomischer Spekulationen geworden. Woher sollten die Investoren denn ihr Wissen über die zukünftige Preisentwicklung der großen Namen bekommen, wenn nicht aus der Presse? Es ist kein Zufall, daß einige der größten, schreibenden Weinkenner in leitenden Positionen bei renommierten Auktionshäusern für Weine wie Sothebys und Christies tätig sind. Überhaupt, ich habe den Eindruck als sei der Wein für seine Liebhaber längst zu einer intellektuellen Herausforderung geworden; und dies nicht nur aus dem subtilen Grund sich Alkohol-Kritiker vom Halse zu halten sondern auch aus schierer Freude an dieser „fröhlichen Wissenschaft“.
Neuerdings hat das Internet als Quelle des Informationsaustausches erheblich an Bedeutung zugelegt. Private Chatrooms und Foren widmen sich emphatisch dem Wein. Sie sind eine großartige Möglichkeit die Soziologie der Weintrinker samt ihres intellektuellen Horizonts zu studieren. Dort gibt es wirklich Interessierte, die fragen und nachhaken. Es gibt die Mini-Parkers, die alles wissen und beurteilen können und es gibt die deutschen Schulmeister, deren Lebenszweck die Belehrung der Unwissenden in Grundsatzfragen ist.