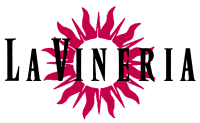Die Ehrfurcht vor der Stille
Seit vielen Jahren beschäftigt mich ein Thema ganz besonders: die Stille. Sie erleben die meisten Menschen vermutlich nur noch selten. Am Arbeitsplatz muss man ständig mit den Kollegen kommunizieren, Telefonanrufe beantworten, viele Dinge zwischendurch erledigen und zu guter Letzt noch die Arbeit bewältigen. Zuhause ist es auch nicht besser: nach dem abendlichen Heimfahrtstress durch verstopfte Straßen, zuhause angekommen plärren die Kinder und der Partner möchte gerne seine Tagesprobleme loswerden. Wenn es dann eigentlich ruhig werden könnte, dröhnt der Fernseher die Stille zu. Dabei wäre es nur erforderlich einen kleinen Knopf zu bedienen um Ruhe zu haben, aber diese zielgerichtete Bewegung können die meisten Menschen nicht mehr aktiv ausführen, denn sie wollen (oder können), wie unter Zwang, ohne die gewohnte Geräuschkulisse den Abend nicht verbringen.
Es gab Zeiten in denen es völlig normal war, dass zu bestimmten Tages- bzw. Nachtzeiten Ruhe herrschte. Selbst in der Stadt hat damals gelegentlich einmal ein Vogel gezwitschert und das Heulen des Sturms oder ein Gewitter die Stille unterbrochen, aber dies waren dann akustische Ausnahmemomente. Zwar beherbergen unsere Städte mittlerweile eine Vielzahl von Vögeln und anderen Tieren (Eichhörnchen, Kaninchen etc.), die werden aber kaum mehr wahrgenommen. Heute sind Hektik, Lärm und Krach der Normalzustand und das Verwunderliche daran ist, dass es den betroffenen Bürgern zum großen Teil gar nicht ins Bewusstsein dringt, sie haben es widerstandslos akzeptiert und sind darin ihren vierbeinigen Nachbarn mit den Langohren auf der Gallus-Anlage im Frankfurter Stadtzentrum recht ähnlich. Ja, ich befürchte, dass viele die Stille überhaupt nicht mehr „ertragen“ könnten und sie deshalb meiden. Lässt sich so ein Verhalten psychologisch analysieren? Vielleicht ja, wenn man davon ausgeht, dass die audio-visuelle Alltagsbelastung als ein sehr wirksames Mittel der Ablenkung angesehen wird. Wessen Sinne ständig gefordert werden, der kommt nicht mehr zum Nachdenken. Das könnte der eigentliche Zweck dieser ständigen Bilder- und Tonbelastung sein, denn kämen sie tatsächlich zum Nachdenken würden viele Mitmenschen einsehen, dass sie nicht wirklich glücklich sind. Selbst wenn sie ins Konzert gehen und Musik hören, empfinden sie das Gehörte häufig nur als Geräuschkulisse und schwadronieren in ihrer eigenen Gedankenwelt anstatt der Musik aktiv zuzuhören. Der Konzertbesuch ersetzt dann auf eine gewisse Weise die häusliche Stille.
Unter „Lärm“ verstehe ich jede Art von unkontrolliertem sinnlichem Reiz, der kann akustisch, visuell, olfaktorisch oder taktil sein. Ein Überangebot an Farben und Formen ist visueller Lärm, während eine konkurrierende Gleichzeitigkeit von Düften olfaktorischer Lärm ist. Die Selbstreflexion, das Hinterfragen und Nachdenken über das eigene Leben, die eigenen Emotionen und die Analyse des eigenen Handelns, benötigt nun einmal Ruhe und Muße und kann sich bei Lärm nicht entfalten. Man muss sich von der 24-Stunden- Rundumversorgung mit Radio-, Fernseh- und Internetgetöse lösen um in sich hineinzufühlen und Antworten auf die in der Stille entstandenen Fragen zu finden. Ich glaube, dass der Weg zu einem gesunden, erfüllten und glücklichen Leben auf Dauer nur über das Abschalten von unnützen Lärm-Einflüssen jeder Art gehen kann. Denn nur in der Ruhe können wir sowohl unsere negativen als auch unsere positiven Erlebnisse mental verarbeiten. Häufig geht es ja bei der Selbstreflexion darum alte Glaubenssätze, die schon Bestandteil von unserem Ego waren, wieder aufzulösen und dafür neue und für unsere jeweilige, akute Situation adäquate Vorstellungen zu übernehmen. Die Zwänge der Gesellschaft müssen überwunden und Vorurteile, seien sie gegen andere Menschen oder andere Verhältnisse gerichtet, müssen verschwinden, d.h. sie müssen abgebaut und alte Zöpfe abgeschnitten werden. Aber die Selbstbetrachtung besitzt auch eine spirituelle bzw. eine seelische Komponente, sie reicht von persönlichen Aspekten des geistigen Wachstums bis hin zu Glaubensfragen. Selbstkritisches „Nachdenken“ ist zwar leicht zu fordern, aber unendlich schwer umzusetzen und erfordert Erfahrung und unser ganzes psychisches Engagement.
Stille ist eine akustische Qualität, die nicht nur Entspannung und Ruhe bedeutet, Stille kann auch sehr bedrohlich sein. Um dies zu verdeutlichen möchte ich auf eine ganz intensive Szene in Werner Herzogs Film „Aguirre der Zorn Gottes“ zu sprechen kommen: Eine Gruppe spanischer Eroberer befindet sich irgendwo auf einem südamerikanischen Fluss auf einem Floß unterwegs und sucht das gelobte Phantasie-Land, das sie „El Dorado“ nennen. Hinter beiden Ufern erstreckt sich dichter Urwald aus dem das Schreien und Krächzen von Vögeln und anderem Dschungellebewesen auf den offenen Fluss hinausdrängt. Vor Kurzem wurde einer ihrer Männer von einem vergifteten Pfeil getroffen, was Beweis genug war, dass auch feindlich gesinnte Eingeborene im Dickicht hinter dem Ufer lebten. Plötzlich wurde es ganz ruhig in der Natur, die Tiere schwiegen, nichts regte sich, kein Laut war zu hören. Den Leuten auf dem Wasser wurde bewusst, dass dies die Stille vor einem Sturm bzw. vor einer Attacke war und, dass ein Angriff der Flussanwohner kurz bevorstand. Die versteckte Angst der spanischen Krieger überträgt sich auf die Betrachter des Films, die die unerträgliche Stille auf der Leinwand ihrerseits durch lautes Schreien und Rufen am liebsten unterbrechen würden. Eine cineastisch genial inszenierte Situation, die auch den aggressiven Aspekt der Stille verdeutlicht. Es ist nicht ein Gefühl innerer Leere oder der Einsamkeit, wie sonst gelegentlich in der Stille. Die Angst vor der Stille ist in diesem Fall vielleicht vergleichbar mit der Angst vor der Dunkelheit. Die Leere an optischen oder akustischen Reizen lässt Gedanken aufkommen, die entweder der Phantasie oder früherer, unangenehmer Erfahrungen entspringen. Um diese zu vertreiben beginnen Kinder bekanntlich im Dunklen laut zu singen und Erwachsene pfeifen in der gleichen Situation ein Liedchen.
Musikalische Beispiele der Stille
Im Zusammenhang mit der Bedrohung durch die Stille möchte ich ein weiteres, diesmal musikalisches, Beispiel bringen. In seiner „Alpensinfonie op. 64“, einer musikalischen Huldigung an seine oberbayrische Heimat, malte Richard Strauss (1864 – 1949) in Tönen das Bild vom Gipfelabstieg und das Aufkommen eines Gewitters. Dabei gibt es einen kleinen Abschnitt, in dem die Stille vor dem Sturm musikalisch sehr eindrücklich dargestellt wird. Dieses schöne musikalische Gemälde ist die letzte Tondichtung des Komponisten und auch sein rätselhaftestes Werk. Im Symphonieorchester kommen hier eine Wind- und Donnermaschine sowie Kuhglocken und eine Orgel zur Anwendung und helfen mit, tatsächlich etwas Bedrohliches in die Ruhe vor dem Sturm zu zaubern. Auf die Widersinnigkeit Stille mit Tönen beschreiben zu wollen sei an dieser Stelle hingewiesen. Ich kann nur sagen, dass Strauss diese, auf den ersten Blick absurd erscheinende Aufgabe großartig gemeistert und Stille, im Sinne von klingender Stille, hörbar gemacht hat!
Da ist aber noch ein anderer, interessanter Aspekt in Zusammenhang der Stille und akustischen Empfindungen. Höhlenforscher berichten gelegentlich, dass sie, wenn sie tief unter der Erde in unterirdischen Gängen die „absolute Stille“ erfahren, ganz konkret menschliche Stimmen oder Geräusche von vermeintlich anwesenden Tieren hören. Sie, die nüchternen Naturwissenschaftler, nehmen diese Eindrücke so realistisch wahr, dass sie beginnen die gehörten Wesen in der Höhle zu suchen. Diese akustische Fata Morgana lehrt uns eines: der Mensch hat die Fähigkeit die Stille mit Tönen aus seinem eigenen Inneren zu füllen. Schönstes und gleichzeitig menschlich traurigstes Beispiel dafür ist die letzte Schaffensperiode von Ludwig van Beethoven, in der er bekanntlich taub war.
Ein Musikstück setzt sich nicht aus einem permanenten und kontinuierlichen Fluss von Noten zusammen, sondern enthält gelegentlich auch Augenblicke der vollkommenen Stille, die sog. Generalpausen. In diesen Momenten ruhen alle Instrumente, dies sind aber keine „Verschnaufpausen“ für die Musiker, sondern vom Komponisten sorgsam ausgewählte Stilmittel, die die Struktur und den Inhalt des betreffenden Stückes erläutern sollen. In diesen überraschenden Momenten ohne Musik mitten in einem Musikstück hat der Zuhörer die Möglichkeit seine eigenen, imaginierten Töne einzubringen, was ihn gleichsam zum „Mittäter“ des Komponisten macht und seine Freude an der Musik steigert. Als Beispiel zweier solcher kurzen, aber sehr effektvollen Besinnungspausen kurz nach einander möchte ich den letzten, langsamen Satz von Tschaikowskys Symphonie Nr. 6, der sog. „Pathetique“, anführen. Der große Geiger Yehudi Menuhin (1916 – 1999) hat es mit Bezug auf Beethovens Musik folgendermaßen ausgedrückt („Kunst als Hoffnung für die Menschheit“, Piper Verlag, München, 1986): „Vielleicht sind mir als Musiker jene schweigenden Stellen bei Beethoven (in der Musik nennen wir sie Fälschlicherweise „Pausen“) die liebsten, die wie der leere Raum zwischen zwei aufgeladenen Gewitterwolken die Kraft des Blitzes in sich tragen.“
Lärm durch die Stimme
Eine wichtige Quelle des täglichen Lärms, der immer wieder über uns hereinbricht, ist die menschliche Stimme. Sie ist wesentlicher Bestandteil der Kommunikation von Personen untereinander. Mit dem Begriff Kommunikation meinen wir den Austausch von Informationen aller Art. Kommunikation kann verbal oder nonverbal geschehen. Sich verbal, d. h. mit der Sprache mündlich oder schriftlich mitzuteilen stellt den Löwenanteil unserer kommunikativen Tätigkeit dar. Im gesprochenen Wort finden sich alle Register emotionaler Ausdrucksmöglichkeiten. Dazu kommunizieren wir paraverbal, was bedeutet, dass die Art und Weise wie gesprochen wird erhebliche Bedeutung gewinnt. Solche Nuancen wie der Tonfall, das Sprechtempo oder die Lautstärke helfen uns zusätzlich zum Wort unsere Botschaften mitzuteilen. Schreien und brüllen wird von vielen Menschen als abstoßend, zartes Abstufen der Worte dagegen meist als angenehm empfunden. Laute oder schrille Sprache, wie auch Geplärre von Kleinkindern (außer den eigenen), kann nicht selten unter die Kategorie Lärm fallen und ist damit ein ausgewiesener Feind der Stille. Die ausgeprägteste Form der nicht verbalen Kommunikation ist das Schweigen. Wie in manchen spirituellen oder religiösen Gemeinschaften, bei denen ein Schweigegebot herrscht, sehr deutlich wird, ist intensive Kommunikation tatsächlich auch ohne Worte möglich. Wir benutzen dazu die Körpersprache, die Gestik, den Augenkontakt oder die Mimik. Wir alle haben im Laufe des Lebens gelernt, sich nonverbal mitzuteilen, aber wir nutzen dies eher unbewusst und selten. Warum eigentlich, wenn es doch eine so effektive Art der Lärmvermeidung darstellen könnte? Rein philologisch gesehen gibt es kein Schweigen ohne Rede – aber auch keine Rede ohne Schweigen. Schweigen ist ganz grundsätzlich an die Sprache und daher an zwischenmenschliche Kommunikation gebunden. Dem Schweigen gegenüber steht das „Stillsein“ eines Menschen, der mit sich alleine und zufrieden, gleichsam selbstgenügsam, ist, d.h., dass er in dem Augenblick überhaupt nicht mehr kommunizieren muss, also auch nicht non-verbal. Nur im Stillsein erleben wir den Rhythmus unseres Innersten: die Egozeit. In meiner ganz persönlichen Ichzeit erlaubt mir das Schweigen meine innersten Schwingungen zu spüren und die innere Stimme zu hören.
Die Stille und Gaumenfreuden
Eine wichtige Rolle spielt die Stille auch beim kulinarischen Genuss, zu dem ja der Weingenuss im weiten Sinne auch gehört. In einem Fernsehinterview hat die berühmte österreichische Sterne-Köchin Johanna Maier aus der Steiermark einmal bekannt, dass sie beim Abschmecken ihrer preisgekrönten Speisen absolute Stille braucht. Nur dann könnten sich ihre Geschmacksnerven voll auf die Aromen konzentrieren. Dies ist eine Erfahrung, die jeder Gourmet in ähnlicher Form schon einmal selbst gemacht hat: „auch das Ohr isst mit“. Bei lauten, unharmonischen Geräuschen verschwinden die feinen Nuancen des Geschmacks. Dagegen kann zarte, harmonische Musik die Freude am Essen verstärken. Nicht viel anders ist es beim Weingenuss. Es scheint als sei sinnliches Multitasking nicht einfacher als das gleichzeitige Bewältigen unterschiedlicher physischer oder psychischer Aufgaben, dem alltäglichen Multitasking. Schon das Alte Testament gibt Aufschluss über die Zusammenhänge von Ruhe und Genuss: in der biblischen Darstellung war Noah der erste Weinbauer. Nach dem Zurückweichen der Sintflut landete er mit seiner Arche am Berg Ararat im Taurusgebirge, in der heutigen Osttürkei. Dort pflanzte er einen Weinberg. „Er trank von dem Wein, wurde davon trunken und lag entblößt in seinem Zelt.”, so ist im ersten Buch Mose zu lesen. Viele tausend Jahre später, auf Tizians grandioser Huldigung an den Wein, dem „Bacchanal von Andros”, genießen entblößte Menschen den Wein und symbolisieren damit die Sinnlichkeit beim Weintrinken, die offenbar auch schon Noah erfahren hatte. Sein Name stammt aus dem Hebräischen und heißt „Mann der Ruhe”, was vielleicht auf seine „Siesta” nach dem Weingenuss im Zelt Bezug nimmt. Auf Tizians Gemälde ist auch die Musik vertreten: unter einem Baum steht ein singendes Pärchen, ein anderes tanzt davor zu den beschwingten Melodien und die beiden jungen Frauen im Vordergrund machen gerade eine Pause mit ihrem Blockflötenspiel. Auf dem Notenblatt vor ihnen erkennt man den Schriftzug „Chi boyt et ne reboyt il ne seet que boyre soit“ Dieses Altfranzösich kann man folgendermaßen übersetzen: Wer trinkt und nicht wieder trinkt, weiß nicht was trinken ist. Wenn es jedes Mal in einem, wie von Tizian gemalten, Bacchanal mündet, wer wäre da nicht gerne dabei?
Lebensgeschwindigkeiten
Ein nicht zu vernachlässigender Faktor bei der subjektiven Empfindung der Stille ist die sog. „Lebensgeschwindigkeit“. Diese drückt letztendlich die Anzahl der Aktivitäten eines Menschen pro Zeiteinheit aus. Sie ist die Grundlage der ominösen Zeitverdichtung, die heutzutage von fast allen Berufstätigen gefordert wird. Auch im Privatleben haben wir gelernt mit dieser Komprimierung der Zeitinhalte mehr schlecht als recht zu leben, da es von der Gesellschaft so gefordert wird. Wenn die Inhalte aber zu dicht aufeinander folgen, bewältigen die Menschen bzw. deren Psyche dies gelegentlich nicht mehr. Die Energie ist dann schnell erschöpft und es kommt zum seelischen Kurzschluss (burn-out). Wir ahnen es irgendwie, was unter Lebensgeschwindigkeit zu verstehen ist, aber gibt es dafür einen Tachometer? Kann man diese Geschwindigkeit tatsächlich messen? Der amerikanische Psychologe und Zeitforscher Robert Levine hat es versucht. Seine Methodik sieht auf den ersten Blick beinahe banal aus, er hat nämlich die Geschwindigkeit gemessen, mit der Menschen in verschiedenen geographischen Gegenden der Welt zu Fuß gehen. Tatsächlich hat er große Unterschiede gefunden und diese mit anderen Parametern wie z.B. dem Tragen von Armbanduhren, der Zeit für den Kauf einer Briefmarke auf der Post oder der Genauigkeit öffentlicher Uhren in Zusammenhang gebracht. Wen wundert es da, dass die Schweiz, Japan und Deutschland die Länder mit der höchsten Lebensgeschwindigkeit sind? Jetzt stellt sich mir persönlich die Frage, ob die Beziehung des Lauftempos eines Menschen zu seiner Lebensgeschwindigkeit auch in umgekehrter Richtung existiert, d.h., verringert sich die Lebensgeschwindigkeit, wenn man seine Laufgeschwindigkeit drosselt? Aus eigener Erfahrung glaube ich, dass es tatsächlich so ist. Seit meiner Fußoperation und der damit verbundenen erheblichen Reduzierung meiner Laufintensität und – Geschwindigkeit hat sich mein Leben deutlich verlangsamt. Das kann natürlich reine Koinzidenz mit dem Alterungsprozess sein, aber eben vielleicht auch nicht! Ist es nicht so, dass man häufig beobachten kann, dass Menschen, denen wir Genussfähigkeit und Lebensweisheit zusprechen, sich auch langsamer bewegen, langsamer sprechen und mit allem bedächtiger umgehen? Es ist ein faszinierender Gedanke, dass man durch physische Entschleunigung auch eine psychische Entschleunigung erreichen kann. Wieder einmal wird man auf den engen Zusammenhang von geistig-seelischen und körperlichen Phänomenen hingewiesen.
Das Tempo
Zwar ist James Watt (1736 –1819) nicht der gepriesene Erfinder der Dampfmaschine aber er arbeitete erfolgreich an der Verbesserung ihres Wirkungsgrades und wurde, durch entsprechende Patente geschützt, indirekt zum Mitbegründer des Industrialismus am Beginn des 18. Jahrhunderts. Die Dampfmaschine konnte nicht nur die Tätigkeiten vieler Arbeiter ersetzen, sondern auch neuartige Maschinen bewegen, die dem Erfindergeist einer sehr kreativen Generation entsprangen. Es war das Zeitalter der Aufklärung und die feudale Gesellschaft brach langsam in sich zusammen. Ein Jahrhundert später war der Fortschrittsglaube der Menschen dann gänzlich unerschütterlich: technische Innovationen versprachen dynamischen Menschen Reichtum und soziale Anerkennung. Da die Lebenszeit endlich war, musste, nach dem Motto „Zeit ist Geld“ so viel wie möglich in dieser Zeitspanne erledigt werden um zu materiellem Wohlstand zu kommen und den noch möglichst lange zu genießen. Das Ergebnis war, dass die Lebensgeschwindigkeit immer schneller wurde. Ein interessantes Phänomen in diesem Kontext, sind die Spiel-Tempi, die sich in der Musik mit einer gewissen Zeitverzögerung parallel zur Industrialisierung, immer mehr beschleunigt haben. Bach und Mozart wurden jetzt doppelt so schnell wie zu ihren Lebzeiten gespielt. Unter den Musikern und deren Zuhörern herrschte ein regelrechter „Beschleunigungswahn“. Diese Entwicklung war natürlich eine Voraussetzung für die Instrumentalvirtuosen des 19. Jahrhunderts, wie z. B. Niccolo Paganini oder Franz Liszt. Noch heute erliegen Konzertgänger der Faszination schneller Tempi. Manche Interpreten, wie z. B. Nikolaus Harnoncourt, haben sich gegen diesen Trend gewandt.
Andere, wie John Eliot Gardiner (geb. 1943) oder Glenn Gould (1932 – 1982) haben in ihren Darbietungen wieder mit den Originalgeschwindigkeiten der klassischen Musik „experimentiert“. Alfred Brendel schrieb in seinem Essay „Der missverstandene Liszt“ von 1961: Auch als Dirigent von Beethovensymphonien soll Liszt langsamere Tempi genommen haben, als man sie bisher gewohnt war, und mit ’überraschendem Gewinn für die Wirkung‘, wie eine renommierte Leipziger Zeitung anerkannte.“ Das wirft ein etwas anderes Bild auf das Musizieren von Franz Liszt, zumindest was seine Beethoven-Interpretation betrifft. In diesem Zusammenhang muss ich an die berühmten Worte des Siddhartha Gautama (Buddha 560 – 480 v. Chr.) denken, der nämlich schrieb: „Achte auf die Melodie des Lebens, welche in dir schwingt.“ Uns sollte ständig im Bewusstsein sein, dass die Melodie des Lebens auch von äußeren Einwirkungen, wie der Lebensgeschwindigkeit, beeinflusst wird, und darüber haben wir bis zu einem gewissen Grad die Kontrolle!
Die deutsche Pianistin und Musikwissenschaftlerin Grete Wehmeyer ist in ihrem Buch „Langsam Leben“ (Verlag Herder, Freiburg/Breisgau, 2000) indirekt auf die Zusammenhänge von Musik und Lebensgeschwindigkeit eingegangen. Sie zitiert den kanadischen Pianisten Glenn Gould, der sich über die Tempi beim Spielen von Bachs Goldberg-Variationen folgendermaßen geäußert hat: „…früher war für mich das rhythmische Voranpreschen ungeheuer wichtig; aber je älter ich wurde, desto mehr empfand ich viele Interpretationen (und sicher auch den größten Teil meiner eigenen) als viel zu schnell…“. Als 23-Jähriger spielte er die Variationen von Anfang bis zum letzten Ton in 38 Minuten und 27 Sekunden, 26 Jahre später (1981) brauchte er für das Spielen der gleichen Noten 51 Minuten und 18 Sekunden! Frau Wehmeyer ist auch diesen Weg der musikalischen Verlangsamung gegangen und beschreibt wie schwierig dies war: „Ich übte die Entschleunigung, ja, aber mit Metronom. Ich musste von dieser Maschine dazu gezwungen werden, mich von meiner jahrzehntelang mit Überzeugung eingewöhnten Schnellspielerei zu verabschieden. Sehr, sehr lange dauerte es, bis ich nicht mehr bei dem langsam tickenden Metronom nervös wurde.“ Am Beispiel von Beethovens „Waldstein- Sonate“ beschreibt sie das Ergebnis ihrer Bemühungen am Klavier: „Ich war überwältigt. Nicht zuletzt von der Erkenntnis, dass viele Inhalte bei schnellem Tempo überhaupt nicht zu erkennen sind, also auch keine Wirkung in unserem Inneren haben.“ Wird es uns im Leben genauso wie mit der Musik ergehen, wenn wir es entschleunigen und gemächlicher voranschreiten? Werden wir durch die bewusste Langsamkeit neue Inhalte sehen und zu neuen Erkenntnissen kommen?
Das große amerikanische Multitalent John Cage (1912 -1992) wollte es genau wissen: seinem Orgelwerk „Organ²/ASLSP“ hat er die Tempobezeichnung „as slow as possible“ gegeben. Nach langwieriger Diskussion unter Musikwissenschaftlern und Cage-Forschern aller Couleur über die mögliche Aufführpraxis dieses Stücks kam man zu der Auffassung, dass Cage ein potentiell unendliches Spiel, mindestens jedoch die Lebensdauer der bespielten Orgel, mit seiner Tempoangabe gemeint haben müsste. Aus musikhistorischen Gründen wurde die Burchardikirche von Halberstadt für das „John- Cage-Orgel-Kunst-Projekt“ gewählt und seit Oktober 2013 hören wir dort einen Ton auf fünf Orgelpfeifen einer kleinen Orgel, der in teilweise monatelangen Interwallen abgelöst wird und einen Klangwechsel nach der Komposition von John Cage initiiert. Das Ende der Aufführung ist für das Jahr 2640 geplant. Mit diesem zeitlichen Megaprojekt, das auch von künftigen Generationen getragen werden muss und in das sehr viel Geld und Vorarbeit investiert wurde, soll der Sehnsucht nach Entschleunigung und der sinnlichen Entdeckung der Langsamkeit gehuldigt werden. Der Haupteffekt auf den Zuhörer, der ja bei einem Besuch in der Halberstädter Kirche im Zweifel nur einen gleichbleibenden (meditativen) Ton hört, ist die momentane Bewusstwerdung von Vergangenheit, Gegenwart und einer, hoffentlich friedlichen Zukunft von Jahrhunderten, also die ganze, emotionale Dimension der Zeit. Es ist nicht verwunderlich, dass die experimentelle Unternehmung von Halberstadt mittlerweile weltweites Aufsehen erregt und bei den anwesenden Besuchern Schauer von Gänsehaut erzeugt hat. In eine ähnliche Richtung weisen Uhren, die nur noch einen einzigen Stundenzeiger haben und damit die, insbesondere im Sport praktizierte Genauigkeit der Zeitmessung ad absurdum führen wollen.
Die Zeit der Stille
In seinem „Tractatus logicophilosophicus“ schrieb Ludwig Wittgenstein (1889 -1951): „Wir können keinen Vorgang mit dem „Ablauf der Zeit“ vergleichen – diesen gibt es nicht – sondern nur mit einem anderen Vorgang (etwa mit dem Gang des Chronometers). Daher ist die Beschreibung des zeitlichen Verlaufs nur so möglich, dass wir uns auf einen anderen Vorgang stützen.“ Das sagt aus, dass die Zeit nur an anderen, ins Bewusstsein gelangten, Ereignissen festgemacht werden kann. Wenn aber Ereignisse tatsächlich die Zeit bestimmen, ist diese eine Frage natürlich berechtigt: gibt es überhaupt eine Zeit in der absolut nichts passiert, d. h. in der keine Ereignisse stattfinden? Etwas flapsig ausgedrückt, lässt sich feststellen, dass sich in einem Zeitraum immer irgendetwas ereignet, zumindest so lange ein Mensch bewusst anwesend ist. Die Arbeit seines Herzens, seiner Lungen und seines Gehirns sind die Ereignisse, die dann notwendigerweise stattfinden müssen. Bei konventioneller Betrachtung kann in einem zeitlosen Zustand der Mensch überhaupt nicht existieren. Ja, ohne Zeit kann es überhaupt kein Leben geben und auch vor den vielen Millionen Jahren als noch keine Menschen existierten, gab es die Zeit denn Dinosaurier und andere Wesen haben auf der Erde gelebt. Der Urknall war schließlich auch die Geburt der Zeit. In der Zeitlosigkeit kann es keine Stille geben. Daraus ergibt sich die logische Konsequenz, dass das „Nichts“ nicht mit Stille gleich zu setzen ist, sondern, dass diese ein mit Leben erfüllter, erlebbarer (aktiver) Zustand ist. Stille muss man schaffen, denn Stille ist nicht einfach da wenn es lautlos ist. Ein akustisches Nichts ist nicht gleichzusetzen mit Stille. Die Stille ist auch ein geistiger Prozess, Stille muss man denken, erst dann kann man sie erleben. Absolute Stille kommt vor dem Tod. Diesen Zusammenhang hat die Sprache mit dem Wort „Totenstille“ schon geschaffen. So bezeichnen wir tatsächlich eine beklemmende Stille, vergleichbar mit der erwähnten Angst-Stille, in dem Fall vermutlich die Angt vor dem Tod. Trotz des gerade Gesagten gibt es selbstverständlich auch eine als „ereignislos“ empfundene Zeit. Sie ist die Grundlage sowohl der Langeweile als auch des Beginns einer bewusst herbeigeführten Entschleunigung.
Ich hoffe es ist deutlich geworden, dass meine Stille nicht die Grabesstille sein kann, sondern eine „tönende“ Stille ist. Was für den logisch Denkenden eine contradictio in adiecto zu sein scheint, ist tatsächlich eine durch Beobachtung der Natur gewonnene Erkenntnis. Die vielfältigen Geräusche des Lebens sind immer zu hören. Schon alleine durch meine Anwesenheit wird die Stille unterbrochen: ich atme, mein Herz schlägt, der Magen knurrt u. s. w. In anderen Worten besagt dies, dass es an keinem Ort der Welt wirkliche Stille geben kann, solange ich selbst als Betrachter anwesend bin, denn ich unterbreche sie ständig infolge meiner Anwesenheit. So gesehen ist Stille immer subjektiv, denn nur wenn sie von mir auch wahrgenommen wird, ist sie meine Wirklichkeit. Das wiederum bedeutet nichts anderes als, dass man Stille hört, wie ihr Gegenteil, den Krach. Lautlose oder tönende Stille ist ein wesentlicher Bestandteil unseres täglichen Hörerlebnisses und als solche höchst subjektiv. Meine Stille muss nicht die deine oder eure sein! Stille ist ein abstrakter Begriff, vergleichbar mit „Schönheit“. Sie ist subjektiv existent, wie sie aber wahrgenommen wird, hängt vom jeweiligen Betrachter bzw. Zuhörer ab.
Für manche hat der Corona-Notstand eben diese großartige Erfahrung der Entschleunigung möglich gemacht, nämlich die Entschleunigung der Lebensgeschwindigkeit zu erleben. Obwohl es eine „Zwangsentschleunigung“ war hat sie mir und vielen Mitbürgern deutlich gemacht, dass wir einen Großteil der Aktivitäten, die uns lieb geworden waren, überhaupt nicht brauchen. Das betraf Reisen, Restaurantbesuche, Kino und Konzerte und, je nach den individuellen Lebensumständen, unzählig vieles andere. Es wurde still. Zugegeben, bei den erwähnten Geräusch-Abhängigen hat sich mit der Krise eine ganz andere Erlebniswelt aufgetan: sie erinnern sich mit Grausen an die sich zuhause langweilenden Kinder und die ständige Notwendigkeit sie zu beschäftigen. Die eigene Langweile konnte unerträglich sein, da half dann auch der lauteste Krach im Hause nichts mehr und man musste hinaus gehen. Demgegenüber hat mir persönlich die Entschleunigung unversehens zusätzliche Zeit gegeben, Zeit zu denken und Zeit bewusst zu leben. Ich habe diese Gelegenheit dankbar aufgegriffen und mich intensiv mit einem ganz besonders interessanten und relevanten Aspekt der Zeit beschäftigt, nämlich der subjektiven Zeit, oder wie ich sie einmal in einem Essay genannt habe, die „Egozeit“. Dies ist jene Zeit, die keine Uhren kennt und deren Ablauf und Inhalt und Erleben ausschließlich von mir selbst bestimmt wird. Es ist die Zeit in der u. U. ein Augenblick zu einer kleinen Ewigkeit werden kann.
Ich bitte um Vergebung, wenn ich diesen Abschnitt mit den vier Anfangszeilen der „Auguries of Innocence“ (Prophezeiungen der Unschuld) von William Blake (1757 – 1827) abschließe, denn sie fassen das oben Geschriebene wunderbar poetisch zusammen:
To see a world in a grain of sand
And a heaven in a wild flower,
Hold infinity in the palm of your hand
And eternity in an hour.
Meine Zeit – die „Egozeit“
Die britische Autorin Virginia Woolf (1882 -1941) hat jene subjektive Zeit als „Moment of being“, Augenblick des Seins, bezeichnet. In diesem, von ihr eindringlich beschriebenen Augenblick geschieht genau das Unmögliche: ein Moment unseres Lebens wird zu einer Ewigkeit. Woolf hat einem ganzen Buch den Titel „Moments of Being“ gegeben und darin schrieb sie in einem Essay mit der Überschrift „A Sketch of theast“ (ich verzichte, wegen der schönen Sprache, auf die Übersetzung): “The past only comes back when the present runs so smoothly that it is like the sliding surface of a deep river. Then one sees through the surface to the depths. In those moments I find one of my greatest satisfactions, not that I am thinking of the past; but it is then that I am living most fully in the present.”
In der Gegenwart zu leben: eine genauere Beschreibung der “Egozeit” ist, wie ich finde, kaum vorstellbar. Die Autorin sieht nicht auf der Wasseroberfläche das eigene Gesicht, wie einst Narziss, der sich in sein Spiegelbild verliebte, sondern sie sieht in die Tiefe des Wassers, was einem Blick in die Tiefe der Seele gleicht. Voll in der Gegenwart zu leben ist das größte Glück, das einem Menschen widerfahren kann. Diese Egozeit, die nichts anderes ist als Gegenwärtigkeit, stellt letztlich die ultimative Verdichtung unseres Zeitgefühls dar. Eine Intensivierung darüber hinaus ist nicht möglich.
Eine andere Frau, Sofia Gubaidulina (geb. 1931), die bedeutende, russische Komponistin, hat es, mit Blick auf die Kunst, etwas anders ausgedrückt: „Das wichtigste Ziel eines Kunstwerks ist die Verwandlung der Zeit. Der Mensch hat diese verwandelt andere Zeit – die Zeit des Verweilens der Seele im Geistigen – in sich. Doch kann sie verdrängt werden durch unser alltägliches Zeiterleben, in dem es keine Vergangenheit und keine Zukunft, sondern lediglich das Gleiten auf dem schmalen Grat einer sich unablässig bewegenden Gegenwart gibt. Die Aktivierung der anderen, essenziellen Zeit kann im Kunstwerk stattfinden.“ (zitiert nach „Ein Hauch der Gottheit ist Musik“, hrsg. Von Meinrad Walter, Patmos Verlag, Düsseldorf 2009). Mir gefällt es sehr die Egozeit „essenzielle Zeit“ zu nennen, denn sie ist tatsächlich ein ganz zentraler Aspekt unseres Zeitgefühls und interessanterweise auch durch Kunst erlebbar. Für Gubaidulina ist die Gegenwart etwas anderes als für Virginia Woolf, nämlich die Augenblicke in denen man gestört wird und sich von sich selbst ablenken lässt. Die Aussagen beider Frauen widersprechen sich überhaupt nicht, sie ergänzen sich!
In fernöstlichen Kulturen spielt die Stille eine sehr viel größere Rolle als in unserer lärmbasierten, eurozentrischen Welt und es kann eigentlich nicht verwundern, dass sich immer mehr Menschen in unseren Breitengraden asiatisch geprägten, mentalen Techniken wie Yoga, Meditation oder Bewegungskünsten wie Taichi u.a. zuwenden. Darauf möchte ich an dieser Stelle ganz bewusst nicht eingehen. Auf den engen Zusammenhang von Natur und Stille ist Erich Maria Remarque (1898 -1951) in einem Brief von 1937 an Marlene Dietrich (1901 – 1992), seine damalige Geliebte, eingegangen: „Wir werden die Zeit mit vollen Händen verstreuen, wir werden keine Ziele und keine Termine und keine Uhren mehr haben, wir werden Brunnen sein, die ineinanderfließen, die Dämmerung und die Sterne und die jungen Vögel werden sich in uns spiegeln, der Wind wird über uns hingehen, die Erde wird zu uns sprechen und in der Stille des goldenen Mittags wird Pan sich lautlos über uns neigen und mit ihm alle Götter der Quellen, der Brunnen, der Wolken, der Schwalbenflüge und des verschwebenden Lebens.“ Mir haben diese Zeilen eines verliebten Träumers sehr gut gefallen. Der Realist, der mit seinem Buch „Im Westen nichts Neues“ den Prototyp eines Antikriegsromans geschrieben hat, bezaubert mit diesen poetischen Sätzen seine Geliebte und auch noch ganze Generationen nach ihm, wir spüren was der Autor sagen möchte, nämlich, dass Stille und Zeit eine Einheit sind.
Die Egozeit ist so etwas wie die Konzentration auf unseren eigenen Geist. Auch die Musik kann dies in hervorragendem Maße bewerkstelligen. Musik erleben bedeutet immer Gegenwärtigkeit. Dabei habe ich für mich selbst festgestellt, dass das Tempo der Musik eine entscheidende Rolle für die bei mir ausgelösten Emotionen spielt. Während mich früher das „allegro con brio“ des letzten Satzes von Beethovens 7ter regelmäßig vom Stuhl gerissen hat, erzeugt bei mir heute das „Adagio sostenuto“ der Hammerklavier-Sonate des gleichen Komponisten metaphysische Lust. In der Übersetzung „zurückhaltend geruhsam“ klingt der Begriff adagio sostenuto außerdem wie die Beschreibung der neuen Lebensgeschwindigkeit in der Corona-Pandemie. Die Vorliebe für maßvollere Tempi in der Musik scheint im Alter zuzunehmen. Diese Beobachtung habe ich nicht nur an mir selbst gemacht, sondern sie wurde mir von vielen gleichaltrigen Musikfreunden bestätigt und kann, wie uns Musikhistoriker erklären, eine vermeintliche Rückbesinnung auf vorindustrielle Zeiten sein, in denen wesentlich langsamere Tempi üblich und damit die damalige Lebensgeschwindigkeit angemessener reflektiert wurde. Die Steigerung der Langsamkeit bis zum endgültigen Verschwinden des Taktes mündet in der Stille. Gilt die Aussage der österreichischen Wissenschaftsforscherin Helga Nowotny (Eigenzeit, Frankfurt 1993) „Erst vor dem Hintergrund von Schnelligkeit lässt sich Langsamkeit ausmachen und erleben“ auch für die Musik? Ich meine ja, denn der Wechsel der Tempi trägt erheblich zu der Spannung in einer Komposition bei.
Ich erinnere mich an ein Konzert wo nach den bombastischen Tönen von Bruckners 6ter Symphonie der Dirigent nach den letzten verklungenen Noten die Hände still in der Luft hielt, als wollte er weiterdirigieren, aber der Stab rührte sich nicht und es war absolute Stille im Konzertsaal. Selten habe ich Ruhe so bewusst erlebt und genossen. Das Publikum und das Orchester waren in dem riesigen Raum eng beisammen, man spürte physisch die Nähe zu den anderen. Wir, die vielen Hundert als Publikum, schwiegen voll seelischer Spannung erschüttert und wurden zu einer Gemeinschaft, die erst durch den Donnerschlag des Applauses aus ihren Wachträumen gerissen wurde. Die Zeit der kollektiven Stille war ein ganz intensives Erlebnis meines persönlichen Zeitempfindens. Ich kann unmöglich sagen wie lange dieses Zeitfenster der absoluten Ruhe gedauert hat, vielleicht waren es nur Sekunden sagte mir die Vernunft, mein Gefühl wollte Stunden daraus machen. In der Stille konnte ich die Zeit förmlich „rinnen“ hören. Ich spürte es ganz deutlich: dies war eine akustische Verneigung an den Komponisten, dem die Stille gewidmet war. Diese kurze Zeitspanne der Ergriffenheit bzw. sich Hingebens an die Emotionen, die die Musik ausgelöst hatte, ausschließlich dem Komponisten zu weihen, finde ich eine wunderbare Idee. Es war wie in einer Mondnacht im Winter, nichts regte sich und ich erinnerte mich an ein Zitat, welches ich vor Jahren gehört hatte und das angeblich vom großen Pianisten Wladimir Horowitz (1903 – 1989) stammte: „Es ist die Stille, die zählt, nicht der Applaus. Jeder kann Applaus haben. Aber die Stille, vor und während des Spiels, das ist das Größte.“ Auch die erwähnte Stille vor dem Applaus zählt selbstverständlich dazu. Ich möchte diesen kurzen Gedankensprung zur Bedeutung des Dirigenten oder der Dirigentin mit einem humorvollen Gedicht von Franz Werfel (1890 – 1945) abschließen (Der Dirigent):
Er reicht den Violinen eine Blume
Und ladet sie mit Schmeichelblick zum Tanz.
Verzweifelt bettelt er das Blech um Glanz
Und streut den Flöten kindlich manche Krume.
Tief beugt das Knie er vor dem Heiligtume
Des Pianissimos, der Klangmonstranz;
Doch zausen Stürme seinen Schwalbenschwanz,
Wenn er das Tutti aufpeitscht, sich zum Ruhme.
Mit Fäusten hält er fest den Schlussakkord;
Dann harrt er, hilflos eingepflanzt am Ort,
Dem ausgekommen Klange nachzuschaun.
Zuletzt, dass er den Beifall, dankend, rüge,
Zeigt er belästigte Erlöserzüge
Und zwingt uns, ihm noch Gröβres zuzutraun.
Das Wort Applaus leitet sich übrigens vom lateinischen applausus (=„Zustimmung“) ab während das deutsche Synonym Beifall wohl seine Wurzeln im heute ungebräuchlichen Verb „beifallen“ hat, was zustimmen bedeutet. Ob Applaus oder Beifall, es ist die Anerkennung der künstlerischen Leistung des Dirigenten und des Orchesters und gegebenenfalls auch des Solisten oder Chorleiters. Ich kann mir vorstellen, dass jeder auf der Bühne ein Ohr dafür hat, wie der Beifall ausgefallen ist: lau, verhalten, stürmisch oder begeistert. Während die Zahl der verkauften Eintrittskarten ein Maß für die Erwartungshaltung des Konzertpublikums ist, Ist der Applaus ein Maß für deren Erfüllung. Der Musiker braucht, wie jeder schaffende Künstler, Anerkennung durch die Liebhaber seiner Kunst, insbesondere, da er ja nichts messbar Nützliches produziert: „La musique pour la musique“ ist das Credo, dem sich Musiker und Zuhörer verpflichtet fühlen und deshalb auf gegenseitige Resonanz angewiesen sind. Schließlich überreicht meist eine Mitarbeiterin der Konzertagentur dem Dirigenten nach getaner Arbeit einen Blumenstrauß, den er etwas verwirrt annimmt, denn was soll er denn damit machen: morgen früh geht sein Flugzeug zum nächsten Ort, da kann er doch die Blumen nicht mitnehmen! Also überreicht er sie der ihm am nächsten stehenden Dame des Orchesters und verwirrt diese damit ebenfalls. Am Schönsten finde ich die Geste die Blumen auf die Partitur zu legen und damit eine Huldigung an den eigentlichen Urheber des heutigen Kunstgenusses, den Komponisten, vorzunehmen.
Ich glaube, dass man bei einer Musikdarbietung die Rolle des Publikums kaum überschätzen kann. Die unüberhörbaren Klagen der Musiker, als sie während der Corona-Krise vor leeren Zuschauerräumen spielen mussten, kamen aus ihrer tiefsten Seele! Musik ist eben ein emotionales Kommunikationsmittel und braucht den zuhörenden Partner und dessen „feedback“ wie u.a. auch den Applaus. Für das Publikum ist der Applaus ein wichtiger Teil des Konzerterlebnisses. Nach dem finalen Ton eines Musikstücks ist die seelische Spannung beim Zuhörer häufig auf ihrem Höhepunkt. Je nach Temperament kostet man diese Augenblicke durch Bewahrung von Stille möglichst lange aus, oder man löst die Anspannung sofort durch den Applaus. Dabei sind mir schon oft Tränen der Freude und Dankbarkeit die Wangen heruntergelaufen. Auch das große Gemeinschaftsgefühl, welches im Konzertsaal während des Applauses entsteht, kann ein Erlebnis sein. Alle im Saal haben offenbar die Sprache der Musik verstanden und waren mit deren Interpretation durch die Künstler auf der Bühne einverstanden. Der Beifall kann auch ekstatische Züge tragen: Bravo-Rufe und stehende Ovationen erinnern an die gewaltige Macht der Musik, deren politische Nutzung in autoritären Regimen ja häufig systematisch betrieben wird.
Für mich ist es ganz unbestritten, dass die Stille nach dem letzten Takt die Musik noch verstärkt und ihr Spannung verleiht. Ähnliche Empfindungen habe ich auch beim „Anblick“ der Stille in manchen Gemälden von Caspar David Friedrich. Was in der Stille wirklich passiert ist wohl besonders eindrucksvoll in dem schon oben zitierten Satz Kurt Tucholskys (1890 – 1935) zusammengefasst: „In der vollkommenen Stille hört man die ganze Welt“. Das ist nicht nur ein Bonmot, sondern enthält eine tiefe Wahrheit: die Töne der ganzen Welt stecken in einem selbst, man muss sie nur zum Klingen bringen! Dazu benötigt man Stille! In seinem „Plädoyer gegen den Lärm der Welt“ hat der Dirigent und Musikpädagoge Franz Welser-Möst (geb.1960) der klassischen Musik eine wichtige Rolle für das bewusste Erleben der Stille zugeschrieben (Franz Welser-Möst: Als ich die Stille fand, Christian Brandstätter Verlag, Wien, 2020). Er selbst hatte bei einem Autounfall auf Glatteis, nachdem das Auto ins Schlingern geraten war um kurz darauf die Böschung herabzustürzen, einen Moment der bewussten Stille erlebt. Nachdem er, im Gegensatz zu einer Beifahrerin, überlebt hatte, konnte er sich an diese Situation genau erinnern und schrieb darüber.
Klingende Stille
Und wieder komme ich zur großen Frage „was ist Stille wirklich“? Wie schon ausgeführt, bedeutet der Begriff vordergründig die Abwesenheit von Geräusch. Stille ist demnach zunächst einmal ein Zustand der Lautlosigkeit. Was wir landläufig Stille nennen ist das Fehlen eines vom Zuhörer entsprechend empfundenen akustischen Reizes. Stille ist auch in mir selbst, sie ist weit mehr als nur Geräuschlosigkeit, sie ist ein seelischer Zustand in dem alle von außen kommenden sensorischen Erregungen zum Verstummen gebracht werden. Mit Stille trete ich einer Welt entgegen, die marktschreierisch und aggressiv Krach und Unruhe in mein Leben bringen will. Der Lärm um mich herum soll mich an der Besinnung auf mich selbst hindern. Allzu häufig wehre ich mich nicht, weil es so viel einfacher ist besinnungslos weiterzuleben. Trotzdem bleibt im tiefsten Inneren die große Sehnsucht nach Stille. Stille hat etwas Metaphysisches, Stille ist heilig! Stille Nacht, heilige Nacht singen wir in einer Zeit der Besinnung. Sei der weihnachtliche Friede auch noch so ein Klischee, im tiefsten Kern drückt er eine menschliche Ur-Sehnsucht aus. Es ist das schrankenlose Verlangen nach Frieden, Entspannung, Ruhe und Harmonie, welches nicht nur in den augenblicklichen Krisenzeiten auch bei mir, ganz im Vordergrund steht. Zu diesem Verlangen gehört auch das Schweigen, doch kann man beim Schreiben schweigen? Man formt die Worte genauso wie im Gespräch, nur spricht man sie nicht aus, sondern schreibt sie nieder. Aber genau dieser intensive innere Dialog, die Aussprache mit mir selbst, ist ja gerade eine der wunderbaren Konsequenzen die die Stille schafft. Die Stille Ist der status nascendi, die Geburt, der Töne! Deswegen benötigen wir sie so dringend zur inneren Kommunikation und suchen immer wieder Stille in der Natur oder in der Kunst. Diese Art von Stille kann nie Geräuschlosigkeit sein, denn es ist die persönliche Stille eines jeden Einzelnen, in der Töne aus der Seele bzw. dem Intellekt vom Inneren an die Oberfläche kommen, oder Töne von außen aufgenommen werden und den Geist erregen.
Die Stille klingt! Wer hat nicht schon einmal erlebt, dass er mit einem guten Freund oder einer guten Freundin im gleichen Raum saß und nur schwieg? Gelegentlich konnte dieses Schweigen erfüllter als jedes Gespräch sein. Es wird plötzlich klar, dass das Sprechen eigentlich im Schweigen verwurzelt ist, insbesondere wenn wir an sinnvolles Sprechen denken. In den Momenten nonverbaler Kommunikation schien es mir immer als würde eine Art von zarter Energie zwischen mir und dem Partner fließen und ein gegenseitiges Einverständnis schaffen. Sich in den anderen einfühlen zu können ist Empathie in ihrer reinsten Ausprägung. Stille hat auch außerordentliche Suggestivkraft: es entstehen Bilder unterschiedlichster Motive. Häufig sind es Landschaften die Ruhe ausstrahlen: Seen, Berge, Wälder, das Meer. „Die größten Ereignisse — das sind nicht unsere lautesten, sondern unsere stillsten Stunden“ soll Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) gesagt haben. Daher können Stunden in der Natur zu so einem immens großen Ereignis werden. Aber die Stille in der Natur müssen wir anders definieren, denn sie ist – ganz wie unsere eigene Stille – nicht lautlos; ganz im Gegenteil, in der Natur spielt ständig die Seele ihre Lieder und Melodien. Nicht jeder hört sie, wer es aber einmal erlebt hat, hat vielleicht den ersten Schritt zum Begreifen des Göttlichen getan. So gesehen ist Stille eigentlich Unhörbarkeit. Gäbe es akustische Lupen oder Mikroskope würden wir die vermeintliche Stille immer zum Leben erwecken können. Mir fällt in diesen Momenten des intensiven Erlebens der Natur der mitreißende Bariton-Solo- und Chor-Beginn des letzten Satzes von Ludwig van Beethovens Neunter ein: „O Freunde, nicht diese Töne! Sondern lasst uns angenehmere anstimmen, und freudenvollere“. Die Töne, die ersetzt werden sollen hat uns der Komponist akustisch nahegebracht: unharmonisch, beinahe dissonant klingende Bläser verdeutlichen den Dissens, den Neid und den Streit unter den Menschen. Aber Erlösung ist in Sicht… und die Musik hat sie!
Wie sehr das persönliche Erleben der Stille auch von äußeren Faktoren abhängig ist, zeigen ihre unterschiedlichen Wahrnehmungen abhängig von den Jahreszeiten. Die Winter- Stille kann eine ganz andere als die Sommer- oder Herbst- Stille sein. Wenn der frisch gefallene Schnee die Töne dämpft oder gar verschluckt kann eine Empfindung, die bis zur Lautlosigkeit reicht, entstehen. Schon als Kind in meiner Oberbayerischen Heimat war ich von der winterlichen Ruhe in der verschneiten Landschaft beeindruckt. Die Winter-Stille ist von vielen Poeten besungen worden, aber kein Gedicht erreicht, meiner Meinung nach, die Intensität von Theodor Fontanes (1819 – 1898) „Alles still!“:
Alles still! es tanzt den Reigen
Mondenstrahl in Wald und Flur,
Und darüber thront das Schweigen
Und der Winterhimmel nur.
Alles still! vergeblich lauschet
Man der Krähe heisrem Schrei,
Keiner Fichte Wipfel rauschet
Und kein Bächlein summt vorbei.
Alles still! die Dorfes-Hütten
Sind wie Gräber anzusehn,
Die, von Schnee bedeckt, inmitten
Eines weiten Friedhofs stehn
Alles still! nichts hör’ ich klopfen
Als mein Herze durch die Nacht; –
Heiße Thränen niedertropfen
Auf die kalte Winterpracht.
Eine der stärksten sinnlichen Erfahrungen habe ich einmal in Granada beim winterlichen Besuch der verschneiten Alhambra, dem magischen Maurenschloss, erlebt. Das transparent leuchtende Licht der Stadt reflektierte in den Stalaktiten-Gewölben und ließ diese wie im Halbdunkel schimmernde Eiszapfen erscheinen. Der silbrig in der Sonne funkelnde Schnee auf den Dächern und am Boden tauchte alles in eine Märchenatmosphäre, in der tatsächlich „heiße Thränen des Glücks auf die kalte Winterpracht niedertropften“. Es herrschte eine dumpfe Stille und die Ästhetik der Alhambra hatte mich überwältigt! In einem Sommer wurde im sog. Myrtenhof Franz Schuberts Notturno in Es-Dur, Op. 148 von einem englischen Klaviertrio gespielt und dabei konnte ich im Innersten spüren, wie die Architektur der Anlage mit der Musik ebenfalls in begeisternder Weise harmonierte. Eine melancholische Harmonie!
Stille und Einsamkeit
Wir assoziieren Stille häufig auch mit Einsamkeit. Wobei Einsamkeit vieles bedeuten kann, zum einen das „Alleinsein“, zum anderen die „Verlassenheit“. Es scheint zunächst als seien die beiden Zustände der Einsamkeit nicht Synonyme, sondern Gegensätze, man kann sehr wohl alleine ohne verlassen zu sein und auch verlassen ohne alleine zu sein. Bewohner einer großen Mietanlage sind definitionsgemäß nicht alleine und trotzdem können sie sich sehr verlassen fühlen. Dagegen kann man sich Menschen vorstellen, die in der Einsamkeit leben und sich überhaupt nicht verlassen fühlen, sondern sehr glücklich sind.
Es ist in unseren Tagen schon beinahe eine Banalität festzustellen, dass in der modernen Massengesellschaft die Einsamkeit der Menschen zum soziologischen Problem geworden ist. Die die Einsamkeit begleitende Stille ist jene Stille, die ich an anderer Stelle schon einmal „Angst-Stille“ genannt habe und die Beklemmung ausdrückt. Diese Stille wird den Menschen aufgezwungen, sie kommt nicht von innen und wird deshalb als negativ empfunden. Hier kommen wir dem Kern schon etwas näher: Stille ist ein höchst subjektiver Zustand und wird ausschließlich über die eigene Wahrnehmung, bzw. Empfindung definiert. Psychologen und Soziologen betonen immer wieder, dass wir Menschen soziale Wesen seien, die in Gruppen zusammenleben und Kontakte pflegen müssten. Sobald ein Individuum an der Erfüllung dieser Grundbedürfnisse für längere Zeit gehindert wird, verändert es sich angeblich auch psychisch, d.h. es wird depressiv und ängstlich, liest man. Wir seien nicht zum Einzelgänger geboren schreiben die Fachleute der Psychologie apodiktisch in ihren Lehrbüchern. Dem möchte ich vehement widersprechen wobei Sigmund Freud mein Gewährsmann ist. Der Begründer der Psychoanalyse schreibt in seinem Essay „Das Unbehagen in der Kultur“ bei der Diskussion von Methoden zur Vermeidung von Unlust: „Gewollte Vereinsamung, Fernhaltung von den anderen ist der nächstliegende Schutz gegen das Leid, das einem aus menschlichen Beziehungen erwachsen kann. Man versteht: das Glück, das man auf diesem Weg erreichen kann, ist das der Ruhe. Gegen die gefürchtete Außenwelt kann man sich nicht anders als durch irgendeine Art der Abwendung verteidigen, wenn man diese Aufgabe für sich allein lösen will“ (Sigmund Freud: „Das Unbehagen in der Kultur (II) in Fragen der Gesellschaft. Ursprünge der Religion“, Fischer Taschenbuch Verlag, 2000). Die aktive Vermeidung von Unlust bedeutet nichts anderes als nach dem „Lustprinzip“ zu leben. Wenn man diese Sätze Freuds ernst nimmt, kann „gewollte Vereinsamung“ als Hinwendung zum Hedonismus und zur Selbstverwirklichung gedeutet werden. So kann man „das Glück“, nämlich „die Ruhe“ erreichen. Da sind wir wieder bei der Stille als Voraussetzung für Erkenntnis.
Ich möchte noch einen Augenblick bei dem von mir so bewunderten Sigmund Freud bleiben. Dieser hat sich nämlich ausgiebig mit Themen der „Bildenden Kunst und Literatur“ (Studienausgabe Band 10, S. Fischer Verlag, Frankfurt 2000). Anhand von Beispielen aus der Malerei, der Plastik und der Literatur untersucht er immer sehr sensibel und scharfsinnig den psychoanalytischen Gehalt von Kunstwerken. Dies ist, auch literarisch, eine außerordentlich anregende Lektüre. Vieles von dem, was er beschrieben hat würde selbstverständlich auch auf die Musik zutreffen, nur einen Hinweis auf die Tonkunst findet sich nirgends. Mehr zufällig bin ich in seinem Essay von 1914 mit dem Titel „Der Moses des Michelangelo“ auf eine Stelle gestoßen an der Freud schreibt, dass Kunstwerke eine starke Wirkung auf ihn ausüben. Er möchte lange bei ihnen verweilen um zu erfassen wodurch sie ihre Wirkung tatsächlich entfalten. Dann fährt er fort „Wo ich das nicht kann, z. B. in der Musik, bin ich fast genussunfähig.“ Dieses Bekenntnis hat mich doch sehr aufgewühlt: der große Versteher und Erklärer der Empfindungen, Gefühle und Affekte lässt sich von der Emotiojnalität der Musik nicht berühren! Die einzige plausible Erklärung, die ich habe ist vielleicht der Umstand, dass Freud sehr deutlich erkannt hat, dass sich die Sinnlichkeit der Musik jeder verbalen Beschreibung entzieht, nach der Devise, die Musik beginnt dort wo die Sprache aufhört.
Einsamkeit ist ein seelischer Zustand, der deutlich komplexerer ist als ich es hier darstellen kann. Manche Psychiater reden gar von Einsamkeit als Krankheit, die auch immer mehr Jugendliche erfasst. (Manfred Spitzer: „Einsamkeit, die unerkannte Krankheit“, 2021). Einer der Gründe dafür ist, gemäß dem Autor, der erhebliche Rückgang der Empathie in der Gesellschaft und der zunehmende Mangel an Einfühlungsvermögen in andere Menschen. Die Gemeinschaft wird häufig ersetzt durch die intensive Nutzung sozialer Medien, die „Freundschaften“ vorgaukeln und deren Umgangssprache banale „Emojis“ sind. Daraus ergibt sich zwangsläufig das Gegenteil dessen, was eigentlich beabsichtigt war, nämlich Unzufriedenheit, eine depressive Grundhaltung und schließlich die Einsamkeit. Auf diesen Trias wiederum können andere Erkrankungen, bis hin zu Krebs, entstehen. Als therapeutische Maßnahmen schlägt der Psychiater Spitzer Aktivitäten vor, die die Menschen einander näherbringen und deren Unlust vereiteln. Musizieren bzw. gemeinsam Musik erleben, spielt dabei eine wichtige Rolle. Dies ist auch Sinn und Zweck der Musiktherapie (Audiotherapie), die gezielt Musik im Rahmen der Wiederherstellung, Erhaltung und Förderung seelischer, körperlicher und geistiger Gesundheit einsetzt. Im gleichen oben genannten Essay (Das Unbehagen in der Kultur) geht Freud noch auf andere Mechanismen zur Vermeidung von Unlust ein und hebt besonders die Drogen hervor; er schreibt: „…aber es ist Tatsache, dass es körperfremde Stoffe gibt, deren Anwesenheit in Blut und Geweben uns unmittelbare Lustempfindungen schafft, aber auch die Bedingungen unseres Empfindungslebens so verändert, dass wir zur Aufnahme von Unlustregungen untauglich werden. Beide Wirkungen erfolgen nicht nur gleichzeitig, sie scheinen auch innig miteinander verknüpft.“ Man benötigt kein Studium der Pharmakologie um zu erkennen, dass Freud die Volksdroge Nr. 1, den Alkohol, im Sinn hatte. Nachdem er die „Leistung der Rauschmittel im Kampf um das Glück und zur Fernhaltung des Elends“ ausgiebig diskutiert hat, geht er, seine ärztliche Pflicht erfüllend, auf deren Gefahr und Schädlichkeit ein. Wenn man mit diesen Gedanken im Hinterkopf, die gewollte Vereinsamung und den Alkohol in Form von Wein zusammenbringt wird ein anderes Mysterium des Lebens offenbar: die Möglichkeit mit dem Wein zu sprechen. Um dieses Zwiegespräch angemessen führen zu können benötigt man Stille, die gleiche Stille, die man auch für den Kunstgenuss braucht. Man muss seinen Körper auf die sinnliche Wahrnehmung konzentrieren und dabei Maß bei der Droge Wein halten.
Langsam und leise
Wie sein baltischer Komponistenkollege Arvo Pärt (geb. 1935) aus Estland ist der lettische Komponist Pēteris Vasks (geb. 1946) ein großer Verehrer langsamer Tempi. In „ZEIT-online“ (28.04.2009) wird er mit folgenden Sätzen zitiert: „In meinen Werken stehen die schnellen Sätze immer für das Aggressive, Brutale, für die dunkle Seite der Menschheit. Das Ideale kommt langsam, piano, als Gesang. Ganz wenige meiner Werke enden im Fortissimo. Meine Musik ist der Choral. Ich komponiere am liebsten stille Musik.“ Stille Musik ist so ein logischer Wiederspruch in sich die wie die tönende Stille, und entgegen aller Vernunft gibt es sie. Die Sänger Simon und Garfunkel haben sie in ihrem mitreißenden Ohrwurm „Sound of Silence“(erste Strophe) eindringlich dargestellt:
Hello darkness, my old friend
I’ve come to talk with you again
Because a vision softly creeping
Left its seeds while I was sleeping
And the vision that was planted in my brain
Still remains
Within the sound of silence
Wieder eine Hommage an Kurt Tucholsky, der in der Stille die ganze Welt gehört hat, was nichts anderes als „the sound of silence“ war! Die Dynamik, d.h. die Stärke eines Tons vom „piano“ zum „fortissimo“ ist eine der intensivsten Möglichkeiten zur Gestaltung eines Musikstückes durch den Solisten oder Dirigenten. Ein wunderbares Beispiel dafür und für die musikalische Darstellung der Stille findet sich gleich zu Beginn von Anton Weberns (1883 – 1945) farbenfrohem, symphonischen Gedicht „Im Sommerwind“. Die Musik steigt pianissimo aus dem stillen Nichts, wie die Morgensonne aus der Dämmerung.
Weißt du, sinnende Seele,
Was selig macht?
Unendliche Ruhe!
So heißt es in dem Poem von Bruno Wille (1860 – 1928) „Im Sommerwinde“, welches die Vorlage für Weberns Musik war. Mir gefällt an diesen Zeilen besonders der Begriff der „sinnenden Seele“ als Synthese von Geist und Emotion. Wenn ich für „sinnen“ die Worte „denken“ oder „reflektieren“ einsetze, komme ich meiner Vorstellung von den abstrakten Inhalten der Musik schon recht nahe. Weberns Stück ist voll von visuellen und akustischen Eindrücken, die das Gedicht von Wille ergänzen bzw. interpretieren. Der Abschluss der Musik, der von der unendlichen Ruhe spricht, verschwindet gleichsam im Nebel des Pianissimo bis zur endgültigen Stille. Webern hat über die Noten geschrieben „bis zu gänzlicher Unhörbarkeit“. In der gesamten Komposition wechseln sich Töne und Stille ab – eben wie an einem Sommertag in der vom kaum spürbaren Wind durchwehten Natur. Trotz aller Unzulänglichkeiten und gelegentlichen Banalitäten ist Weberns „Im Sommerwind“ ein bezauberndes Werk mit dem großen Charme jugendlicher Frische und Unbekümmertheit. Rede ich vom „Göttlichen“ in der Stille so meine ich persönlich keinen konkreten Gott, den ich anreden oder anbeten kann, der auch kein Personalpronomen sein Eigen nennt; mein Gott ist ein abstrakter Begriff und vielleicht mit dem Wort „Schöpfung“ am besten beschrieben. Müsste ich diese Gottesvorstellung als Symbol darstellen, könnte es der „Pantocrator“ (Weltenschöpfer) sein, wie er sich gelegentlich als Mosaik in byzantinischen Kirchenkuppeln oder Apsiden findet. Der Wunsch, den Sinn des Göttlichen zu erfahren und zu begreifen ist, glaube ich, in jedem von uns tief verwurzelt. Die Religionen gehen noch einen Schritt weiter und behaupten, dass man bei Befolgung ihres jeweils eigenen Ritus den Weg zu einem Gott, bzw. zum Göttlichen finden würde. Was immer für einen Weg zu Gott bzw. zur Erkenntnis des Göttlichen der Mensch beschreitet, ohne Stille geht es nicht. Stille und Schweigen sind Teil der Liturgie fast aller Religionen dieser Welt und der Vorhof zum Verständnis des Göttlichen. Wie es der große christliche Mystiker Johannes vom Kreuz (1542 – 1591) einmal ausdrückte: „im Schweigen muss das Wort von der Seele gehört werden“. An dieser Stelle sind wir wieder ganz nah beim Hören, sprich bei der Musik. Das Attribut „göttlich“ passt bekanntlich auf sehr viele Musikstücke und wird in der Beschreibung von Musik entsprechend häufig verwandt. Im Übrigen muss auch diese im Schweigen von der Seele gehört werden! Das aber ist beileibe keine Mystik, sondern die ständige Erfahrung eines Konzertgängers.
Wenn ich die Sehnsucht nach Stille genauer betrachte, beginne ich zu ahnen, dass es, trotz allem, letztendlich die absolute Stille ist, die im Zentrum des Verlangens mancher Menschen steht. Todesstille, Grabesstille. Ist das vielleicht eine versteckte Ausdrucksform der Todessehnsucht? Natürlich hat dies nichts mit dem gleichen Begriff zu tun, den Psychologen benutzen um eine Suizidgefährdung zu beschreiben. Was ich hier meine, hat einen Inhalt etwa wie das zeitlich begrenzte „Fernweh“ und könnte deshalb auch gut „Todesweh“ genannt werden. Es ist, vermute ich, ein Leeregefühl und der unbewusste Wunsch zu neuen Ufern aufbrechen zu wollen um eine unbestimmte, noch undefinierte, Neugier zu befriedigen bzw. ein bestehendes Wissensvakuum aufzufüllen. Der Tod als Ende und Neubeginn einer Zeit? Vielleicht kann es aus philosophischer Sicht wieder einmal die Suche nach Erkenntnis genannt werden? Die allerletzte Erkenntnis des Lebens ist vielleicht die des Wesens des Todes? (Immer wenn man über den Tod schreibt, enden viele Sätze mit einem Fragezeichen). Der Wunsch zu erkennen und zu verstehen hört nie auf, auch im hohen Alter nicht kann aber von Religionen, Weltanschauungen und Konventionen unterdrückt oder beeinflusst werden. Deshalb ist die Stille, und sei es „nur“ die tönende Stille, die Unhörbarkeit, so immens wichtig, denn sie ist der fruchtbare Boden in dem die Saat der Erkenntnis aufgeht!
Stille in der Musik
Ich bin schon kurz darauf eingegangen: Stille ist auch der Mutterboden der Musik. Die Musik bewegt sich in der Zeit, diese ist eine elementare Voraussetzung, dass die Aneinanderreihung von Tönen zu einem geordneten Klangereignis, mit einem akustischen Inhalt wird. Musik ist ein in der Zeit abwechselnder Zustand der akustischen Gegenwart von Schallwellen und Stille. Der Rhythmus des Wechsels und das „legato“, der überspannende Bogen des Zusammenhaltes der Töne, spielen eine bestimmende Rolle in der klassischen Musik. Die Zeit, in der Musik erklingt wird gleichberechtigt durch Melodie, Rhythmus und Pausen geformt. In der Zeit liegt eines der großen Geheimnisse der Musik. Wie im Leben des Menschen gehen auch in einem Musikstück Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ein nicht zu entflechtendes Zeitengewirr ein, denn alle drei Zeitzustände bedingen sich gegenseitig und verleihen der jeweiligen Musik Ausdruck und Emotion. Dabei spielt das Tempo eine ganz entscheidende Rolle, es ist der Geschwindigkeitsgrad mit der sich die Musik bewegt bzw. die Zeit durchschreitet. Das Tempo ist die Seele der Musik. Vielleicht ist es tatsächlich die Zeit, auf die es letztlich in der Musik ankommt und in der die Wahrheit der Musik verborgen liegt. Jede Kunst benötigt ein Medium der Kommunikation. Die Literatur hat die Worte, die Malerei die Farbe, die Bildhauerei das Holz, den Lehm oder den Stein und die Musik den Ton und die Zeit. Töne sind ohne die Zeit, in der sie erklingen oder verklingen, nicht denkbar. Ist deswegen die Musik etwa die Kunst der Zeit oder gar Zeitkunst? Wie auch immer die Antwort auf diese Frage lauten mag, eines wird deutlich: mit dem Verständnis von Musik kommen wir auch dem Verständnis der Zeit ein Stück näher. Aber es ist nicht die Zeit der Chronometer, die uns messbare Objektivität vorgaukeln will, es ist vielmehr die „Egozeit“ (Eigenzeit), die in uns abläuft und die uns Virginia Woolf so eindrucksvoll beschrieben hat.
Vermutlich kennt fast jeder Musikfreund ein Stück, in dem sich seine persönliche Egozeit verwirklicht hat. Dabei kann natürlich kein einheitlicher Maßstab angelegt werden. Jeder hat, entsprechend der Besonderheit seiner Egozeit auch die Musik, die sie zum Schwingen bringt. Für meine Person habe ich schon von dem langsamen Satz aus Beethovens Hammerklavier-Sonate gesprochen, könnte aber ebenso den ersten Satz der Mondscheinsonate, ebenfalls ein adagio sostenuto, nennen. Die vermeintlichen Wellen des Vierwaldstätter Sees im Mondschein sind in meiner Interpretation die Wellen des Zerrinnens der Zeit. Franz Schuberts (1797 -1828) anrührende Vertonung des Gedichtes „Grab und Mond“ von Johann Gabriel Seidl (1804 – 1875) ist eine musikalische Huldigung an die Stille mit jenem grandiosen Schuss Gänsehaut-Romantik, wie sie nur dieser Komponist erdenken konnte:
Silbergrauer Mondenschein
Fällt herab;
Senkt so manchen Strahl hinein In das Grab.
Freund des Schlummers, lieber Mond,
Schweige nicht
Ob im Grabe Dunkel wohnt, Oder Licht.
Alles stumm?
Nun stilles Grab,
Rede du
Zogst so manchen Strahl hinein
In die Ruh;
Birgst gar manchen Mondesblick, Silberblau
Gib nur einen Strahl zurück
„Komm und schau“.
Während „Alles stumm?“ in Schuberts Noten tatsächlich wie das Erlöschen der Sprache klingt, hört sich die Aufforderung „Komm und schau“ wie der Appell an die Kreativität an. Komm und schau, damit Du es weitergeben kannst. In dieser kleinen Musik wird die Verbindung von schöpferischer Kraft mit der Stille für jedermann verständlich besungen. Ein musikalisches Meisterwerk! Auch Kreativität ist ohne Stille nicht denkbar. Sie basiert auf dem Verständnis von Zusammenhängen und dem Zugriff auf neue Ideen und dies kann nur geschehen, wenn der Geist frei ist, d. h. wenn er nicht gestört und abgelenkt wird durch den Lärm der Welt. Eines der großartigsten Beispiele für die enge Beziehung von Kreativität und Stille ist der späte, taube Beethoven. Obwohl er nichts mehr gehört hat, also Stille um ihn war, konnte er einige seiner größten und eindrucksvollsten Werke komponieren. Die 9. Sinfonie ist der überwältigende Beweis für die Notwendigkeit von Ruhe im schöpferischen Prozess. Genau diese Zusammenhänge hat auch die heutige Wellness- Industrie marktschreierisch aufgegriffen und bietet unzählige Ferien-Arrangements an, in denen der zahlungskräftige Kunde die erhoffte Stille finden soll. Dazu gibt es dann gleich Sauna und Entspannungsmassagen. Viel kostengünstiger ist die Art, auf der ich einmal, eher zufällig, die innere Stille erfahren habe.
Meditative Zustände
In manchen Zeiten meines Lebens konnte ich in geradezu meditative Zustände geraten, wenn ich mir mein augenblickliches „Sein“ vorstellte und bewusstwerden ließ. Bei einer typischen, derartigen Situation auf der Terrasse unseres Hauses in der Sierra de la Contraviesa in der Provinz Granada, saß ich auf einem Stuhl, schaute in die Landschaft, hörte die Grillen und die Vögel und wusste bzw. fühlte es sehr stark, dass ich ein Teil des Ganzen war. Ich nahm jetzt sonst unbedeutend erscheinende Einzelheiten wahr: z. B. ein Schmetterling an der Wand, eine emsige Ameise auf dem Fußboden oder eine Eidechse auf dem Stein. Eine wohlige Wärme stieg in mir auf und ich war glücklich. Die Zeit war plötzlich weg, einfach nicht mehr vorhanden oder vielleicht sogar stehen geblieben, genau konnte ich das nicht sagen, es schien aber auch nichts auszumachen, dass ich es nicht mehr wusste. Außerdem herrschte totale Ruhe, ich spürte meine tönende Stille. In mir kam eine merkwürdige Erregung auf und das Gefühl hellwach zu sein und die Empfindung der Intensität des Moments war überwältigend. Eine völlig andere Qualität von stiller Zeit hatte sich meiner bemächtigt. Nach einer unbestimmt langen Periode war ich wieder auf dem Stuhl und wusste, dass ich gerade sehr aktiv gewesen war. Es war ein wenig das Gefühl wie nach dem intensiven Schreiben eines Textes. Schön, dass ich es geschafft hatte, ich war ein wenig stolz auf mich und wusste, dass ich aus meinem Alltags-Ich aussteigen, die Zeit überwinden und Stille finden konnte! Ich habe es später immer wieder versucht derartige Zustände der existentiellen Vertiefung im mein Ich zu erreichen, aber es gelang mir nicht regelmäßig. Wie das Umfeld beschaffen sein und welche Voraussetzungen erfüllt sein mussten, damit ich in diesen Glückszustand kam, entzieht sich bislang noch immer weitgehend meiner Kenntnis. Ich weiß nur, dass Stille dabei eine ganz entscheidende Rolle spielt.
Über die Bedeutung der Stille in der Musik habe ich mich ja bereits ansatzweise ausgelassen. Kann man Stille, dieses „Hörerlebnis“ auch in der bildenden Kunst thematisieren? In der sog. sakralen Kunst wird immer wieder versucht die Stille als Begleitung kontemplativer Praktiken darzustellen: der leidende oder verstorbene Christus am Kreuz, die heilige Familie an der Krippe in Bethlehem, die leuchtenden gotischen Landschaften im Hintergrund, die vergeistigt wirkenden Jünger- und Heiligendarstellungen sind u. a. die Themen um die sich das Erleben der Stille rankt. Der kontemplative Aspekt wurde filmisch ganz großartig von Philip Gröning (geb. 1959) in seinem Dokumentar-Film „Die große Stille“ festgehalten. Er durfte als erster Filmemacher hinter den Mauern der „Grande Chartreuse“, dem Mutterkloster der Karthäuser, dem sog. Schweigeorden, drehen. Herausgekommen ist dabei ein beeindruckendes Dokument über eine Reise in die Stille des Schweigens und der Konzentration. Genau diese Stille ist auch in manchen Bildern zu spüren: ich denke z. B. an die zwei Männer am Meer von Caspar David Friedrich. Ansonsten ist die Vielfalt der Zugänge zur Visualisierung der Stille praktisch unendlich und in vielen Ausstellungen und Büchern festgehalten, so dass eine Aufreihung an dieser Stelle wenig sinnvoll wäre. Seit 1994 gibt es in der Hauptstadt das von dem russischen Maler Nikolai Georgijewitsch Makarow (geb. 1955) gegründete Museum der Stille. Dort soll im Zentrum des turbulenten Großstadtlebens, u.a. auch mit bildender Kunst, Ruhe und Kontemplation ermöglicht werden. Alleine die Existenz einer derartigen Einrichtung macht schon sehr deutlich, wie groß und intensiv heute der Wunsch von Menschen nach Stille sein kann, nur wer fährt schon ins Stadtzentrum um Stille zu erleben?
Der Rausch
Das griechische „Symposion“, bezeichnet heute eine Versammlung von Wissenschaftlern, die dem Austausch von Gedanken und Erkenntnissen dient, in seiner ursprünglichen Bedeutung war es ein Trinkgelage. Die überlieferten Bilder von Symposien stellen meist ein- bis zwei Dutzend Männer dar, die mit Efeukränzen geschmückt, sich auf Liegen räkelnd, Gespräche führen und Wein trinken. Dabei werden sie von Knaben bedient und von Tänzerinnen, Musikantinnen oder Hetären unterhalten. Solche Symposien wurden vielfach idealisiert bzw. ihre Inhalte in der intellektuellen Bedeutung stark überhöht. Das Vieltrinken, einschließlich einer offensichtlich erotischen Komponente, war letztlich ganz sicher wichtiger als die gepflegten Gespräche über alle möglichen Themen. Dafür spricht auch der Kranz auf dem Haupte der Teilnehmer. Der kühl-dunkle Efeu sollte die Sinne klar halten und dem Rausch, sowie dem auf dem Fuße folgenden Kater, Einhalt gebieten. Ihrem Wesen nach waren die Symposien auf die Wohlhabenden der Gesellschaft beschränkt und es wurden, außer den weiblichen Bediensteten, ausschließlich Männer zugelassen. Selbstverständlich wurde die Trunkenheit bei einem Symposion mit völlig anderen Maßstäben gemessen als der Rausch der einfachen Leute. Bei den sozial besser gestellten Teilnehmern der Symposien war der partielle Verlust der Körperkontrolle die notwendige Begleiterscheinung einer kultivierten Zusammenkunft, während bei den unteren Schichten das gleiche als ein bedauerliches Zeichen dafür angesehen wurde, dass man nichts vertrug. Man denke an den lateinischen Ausspruch „in vino veritas“ (im Wein liegt die Wahrheit), denn was war bei einem Symposium wohl wichtiger als ein geistreicher Kopf, der die Wahrheit spricht? Aber die Symposiumsteilnehmer haben ausschweifenden Alkoholgenuss vehement abgelehnt. Als Säufer hat man, meist feindliche, Völker abqualifiziert und sie den „Barbaren“ gleichgesetzt. Übermäßiger Alkoholgenuss wurde von den Griechen mit einem Mangel an Kultur gleichgesetzt. Im liegenden Zustand der Teilnehmer an einem Symposium mag letzteres nur eine geringe Rolle gespielt haben, der Verstand aber sollte sich in einem akzeptierten Normbereich bewegen. Sobald dieser verlassen wird, bewegt sich der „Trunkene“ außerhalb der gesellschaftlichen Grenzen, also durchaus schon so wie noch heute! Übermäßiger Alkoholkonsum ist in unserer heutigen Gesellschaft negativ besetzt, wobei sich der Begriff „übermäßig“ an der Kontrolle unseres Verstandes und der Koordinationsfähigkeit unserer Bewegungen orientiert.
Rauschdrogen und deren Wirkungen
Die Suche nach Bewusstseinsveränderung bzw. -erweiterung durch die Einnahme frei in der Natur verfügbarer Pflanzen, bzw. deren Extrakte mit entsprechender Wirkung, ist vermutlich so alt wie die Menschheit selbst. Ethnologen haben nachgewiesen, dass sich das Aufspüren halluzinogener Stoffe tatsächlich zurück in archaische Kulturen, rund um den Erdball verfolgen lässt. Meskalin aus dem Peyotl-Kaktus und Psilocybin aus Pilzen sind Beispiele für die uralte, rituelle und profane Anwendung von Rauschmitteln. Neben vermeintlich medizinischer Wirkung fanden viele Pflanzenprodukte auch wegen ihrer psychoaktiven Eigenschaften in den europäischen Gesellschaften schon sehr früh Anwendung. Stellvertretend für solche Substanzen in unserem Kulturkreis sei das Opium aus dem Schlafmohn genannt, aber auch der Alkohol gehörte dazu. Dass sich letzterer in unserer Gesellschaft als Rauschdroge so fest etabliert hat, liegt zu einem großen Teil an der deutlich besseren Steuerbarkeit seiner Wirkungen und Nebenwirkungen im Vergleich zu den meisten anderen halluzinogenen Drogen. Aus pharmakologischer Sicht hat der Alkohol offensichtlich eine große „therapeutische Breite“. Die Dosisabhängigkeit seiner gewünschten und ungewünschten Effekte, machte ihn gesellschaftsfähig, denn seine Wirkung ist weitgehend vom Konsumenten lenkbar und liegt daher uneingeschränkt in seiner individuellen Verantwortung. Die Psychologen sagen uns, dass keine Droge in der Lage sei dem Menschen etwas zu geben, was nicht bereits in seinem Unbewussten vorhanden ist. Es besteht scheinbar das Bedürfnis vieler Mitglieder unserer Gesellschaft, dieses Unbekannte aus den Tiefen des Bewusstseins herauszuholen. Das ist nicht eine persönliche Marotte, sondern ein urmenschlicher Trieb. Es ist ja wohl kein Zufall, dass die gegenwärtig so massive Kritik am Alkoholkonsum mit einer Wiederauferstehung und teilweisen Legalisierung des Cannabis-Gebrauchs einhergeht. Rauschdrogen sind ein sehr ernst zu nehmender Faktor in unserer Kultur, da sie potentiell helfen den Wunsch nach spiritueller Erfahrung zu erfüllen.
Es gibt verschiedene wechselwirkende Beziehungen zwischen Stille und einem durch Drogen induzierten Rausch. Im Bereich der Wahrnehmungsänderungen können besonders Substanzen mit beruhigender oder introspektiver Wirkung, wie Alkohol, Cannabis und sog. Psychedelika, stille Räume oder Momente verstärken, da äußere Reize reduziert oder gedämpft werden und innere Erfahrungen vorherrschen. Andererseits kann Stille helfen Drogenwirkungen stärker subjektiv zu empfinden und als Folge davon Emotionen, Gedankenströme oder Angst beruhigen. Auch eine gegenläufige Wirkung von Rausch-Drogen ist dokumentiert: sie können zu Überreizung oder verstärktem Rausch führen. Auch ein kurzzeitiges Gefühl der Losgelöstheit von Gedanken, Gefühlen, Erinnerungen, Identität oder der Umwelt kann vorkommen. Dieser von Psychologen als „Dissoziation“ bezeichnete Vorgang kann zum Empfinden von Stille, gelegentlich auch Angst-Stille, führen. In manchen Ritualen wird Stille genutzt, um die Intensität des Rauscherlebens zu regulieren, z. B. durch kontrollierte Atmung oder stille Reflexion, um „Craving“, jenes unwiderstehliche Verlangen bis hin zum Zwang sich die Droge zu verabreichen, oder „Flashbacks“, d. h. das Wiedererleben einer traumatischen Erfahrung, zu mildern. Stille kann somit Sicherheit, Trost oder Klarheit bieten. Man kann im Rausch regelrecht von einer Selbstberuhigung durch Stille reden.
Zusammenfassend kann man wohl feststellen, dass Stille und Rausch so eng miteinander verknüpft sind wie die Musik mit der Stille. Es ist gut dokumentiert, dass Musiker früherer Jahre, wie Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Richard Wagner, Franz Schubert, Robert Schumann und unzählige andere sich am Wein ergötzt während sie komponiert haben. Welchen Beitrag an ihrer Kreativität war dem kontrollierten Wein-Rausch geschuldet? Wir wissen es nicht. Dagegen wurde uns Musik und Rausch in der Popmusik leider allzu oft durch die tragischen Musikerschicksale, wie z.B. Janis Joplin oder Jimmi Hendrix, vorgeführt, die jeweils an einer Überdosis Rauschgift gestorben sind.